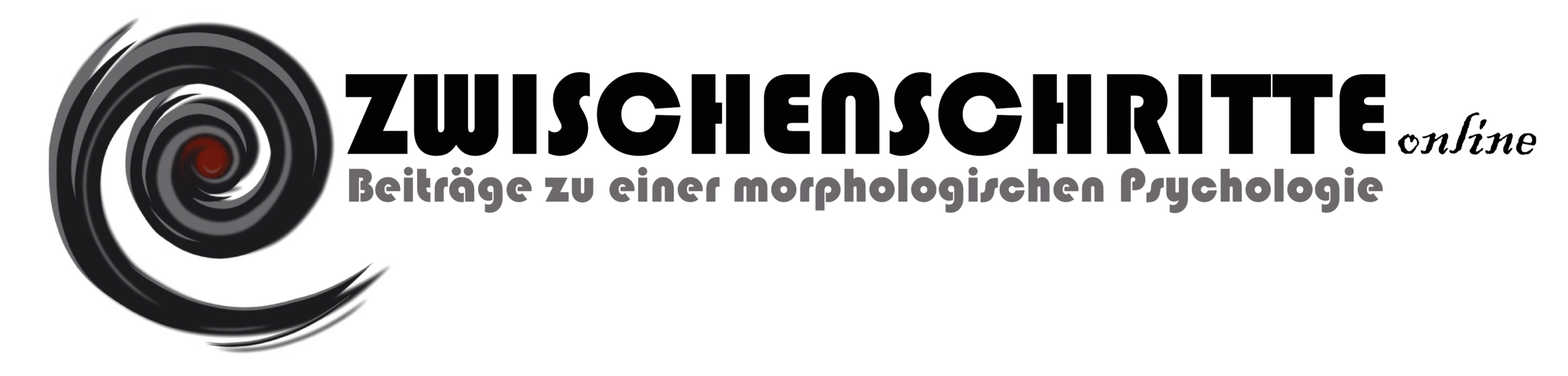Die Kunst des Loslassens – Ein Einblick in die psychologischen Wirkungszusammenhänge des Dart-Wettkampfs
Das Dart-Spielen scheint auf den ersten Blick etwas Banales zu sein. Setzt man dieses vermeintlich Banale in den Rahmen eines mit Bedeutung aufgeladenen Wettkampfs, entsteht ein Wirkungsraum zwischen Leichtigkeit und Anspannung, zwischen Selbstvertrauen und Verunsicherung, Perfektion und Scheitern. Die morphologisch-qualitative Wirkungsanalyse der neun tiefenpsychologischen Interviews mit leistungsorientierten Dartspielern eröffnet einen Einblick in die unbewussten Kräfte, die den Dart-Wettkampf psychologisch ausmachen. Die Erlebensbeschreibungen wurden zusammengefasst, strukturiert und in Form eines Hexagramms in drei Hauptdimensionen des Erlebens geordnet. Hierbei wurden herausstechende Zitate verdichtend rekonstruiert, um zentrale psychologische Themenkomplexe festzuhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Dynamik eines Dart-Spiels erlebt wird als Zuspitzung mit einem drückenden Charakter, der anspannend auf Spieler:innen einwirkt. Dieser Rahmen des Spiels verlangt ein abgeschottetes Für-Sich-Sein, während schon kleinste Impulse das präzise Leisten auf dem schmalen Grat zwischen Erfolg und Misserfolg zum Einstürzen bringen können. Aus diesem Setting heraus begeben sich Spieler:innen auf eine antreibende, rauschhafte Jagd nach Perfektion, während sie sich dauerhaft der Kränkung dieses Perfektions-Gedankens unterworfen sehen.
At first glance, playing darts seems to be something banal. If you place this supposedly banal activity in the context of a competition charged with meaning, a sphere of impact emerges between ease and tension, between self-confidence and insecurity, perfection and failure. The morphological-qualitative impact analysis of the nine depth-psychological interviews with performance-orientated darts players provides an insight into the unconscious forces that psychologically define the darts competition. The explorations were summarised, structured and arranged in three main dimensions of experience in the form of a hexagram. Prominent quotes were summarised and reconstructed in order to capture central psychological themes. The results show that the dynamics of a darts game are experienced as an intensification with an oppressive character that has a tense effect on players. This framework of the game requires players to be in isolation, while even the smallest impulses can cause the precise performance on the fine line between success and failure to collapse. From this setting, players embark on a driving, thrilling hunt for perfection, while they find themselves permanently subjected to the offence of this perfectionist idea.
Sportpsychologie, Darts, Präzisionssport, Erregungsregulation, Selbstvertrauen, Anspannung, Entspannung, Achtsamkeit, Loslassen, Flow
Autor:in
 Autor: Jasper Thöle
Autor: Jasper Thöle
Ausbildung: B.A. Sportmanagement; M.Sc. Sportpsychologie
Grundberuf: Sportpsychologe & Morphologischer Markt- & Kulturforscher i.A.
Tätigkeitsort: Köln
 Co-Autor: Leonard Kai Fuhlert
Co-Autor: Leonard Kai Fuhlert
Ausbildung B.Sc. Wirtschaftspsychologie; M.Sc. Sportpsychologie
Grundberuf: Sportpsychologe
Tätigkeitsort: Berlin
Die Kunst des Loslassens - Ein Einblick in die psychologischen Wirkungszusammenhänge des Dart-Wettkampfs
“Alle Lebenskunst hängt von einer feinen Interaktion zwischen Loslassen und Festhalten ab.” – Havelock Ellis

Von der Kneipe ins Fernsehen
Die Frage nach den Ursprüngen des Dart-Spielens ist von zahlreichen Mythen umgeben, da es keine eindeutigen Aufzeichnungen über die genauen Anfänge des Spiels gibt. Es wird vermutet, dass die heutigen Dartpfeile von den jüngsten pfeilähnlichen Waffen abstammen, die vermutlich zum Zeitvertreib oder als Geschicklichkeitstraining für den Kampf auf Weinfässer-Böden geworfen wurden (Turner, 1985). Das moderne Dartspiel, in der hier behandelten Form, hat seinen Ursprung Mitte des 19. Jahrhunderts in London und anderen Industriezentren Englands. Dort wurde Dart gesellschaftlich als Geschicklichkeitsspiel immer beliebter, wobei es sich auch häufte, dass auf den Ausgang der Dart-Spiele Wetten abgeschlossen wurden (Turner, 1985). Es wird berichtet, dass der Londoner Gastwirt Jim Garside aufgrund solcher Wetten auf Dart-Spiele wegen des Verdachts auf Glücksspiel angeklagt wurde. In seiner Verteidigung überzeugte er den Dartspieler William Anakin, sein Können auf einem im Gerichtssaal aufgestellten Dartboard zu demonstrieren, um so die Richter davon zu überzeugen, dass Dart kein Glücksspiel sei. Diese Demonstration führte zwangsläufig zu einem weitreichenden Urteil: „This is no game of chance“ (Zeit, 2012).
Von diesem Zeitpunkt an durfte Dart als Geschicklichkeitsspiel offiziell in Pubs gespielt werden und wurde schnell zu einem Massenphänomen. 1937 meldeten sich 300.000 Spieler für die Londoner Stadtmeisterschaft, die von der Queen des englischen Königshauses mit einem eigenen Wurf eröffnet wurde (Paulke, 2011). Der erlangte Bekanntheitsgrad trug dazu bei, dass sich Dart als Geschicklichkeitsspiel in den Kneipen der Industriezentren etablierte und damit einen festen Platz in der Gesellschaft einnahm, von dem aus es sich später zu einem professionellen Sport entwickelte. Doch auch trotz fortschreitender Professionalisierung blieb Alkohol ein stetiger Begleiter der Spielkultur und war auch für so manchen professionellen Dartspieler gelebter Alltag: “Seven or eight vodkas before a match ‘to keep my nerves in a proper state” (Jocky Wilson, 2-maliger Weltmeister). Alkohol und Leistung, Kneipe und Sport, das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Doch was schafft eigentlich genau die Faszination am Dart-Spielen? Und warum ist die Kneipe im Dartspielen mindestens genauso relevant wie das Dartspielen in der Kneipe? Das sind Fragen, die sich im Zuge dieses Artikels auf Grundlage einer morphologischen Wirkungsforschung diskutieren lassen. Um das herauszufinden, müssen wir in die Erlebenswelt von Dartspieler:innen im Wettkampf eintauchen und einen Einblick bekommen in die grundsätzliche Architektur des Spiels:
Das übergeordnete Ziel im Dart-Wettkampf ist, 501 Punkte so schnell wie möglich auf 0 zu spielen, wofür man ein Leg zugesprochen bekommt. Eine entscheidende Regel ist an dieser Stelle, dass der letzte Wurf, mit dem man das Leg für sich entscheidet, ein Doppel-Feld des äußeren Rings treffen und die Punktzahl genau auf 0 bringen muss (DRA, 2012). Diese Besonderheit prägt von vornherein den Charakter des Spiels und wie es sich im jeweiligen Moment entwickelt. Versetzt man sich in das Bild eines Wett-Rennens, kann das Herunterspielen (‚Scoren‘) als Rennen und das Beenden des Spiels (‚Finishen‘) als Über-die-Ziellinie-laufen betrachtet werden. Man kann zwar ein gutes Rennen laufen, aber Sieg oder Niederlage wird darüber entschieden, wer als erstes über die Ziellinie kommt. Im Hinblick auf den Dart-Wettkampf bedeutet dies, dass man den Lohn eines schnell herunter gespielten Legs nur bekommt, wenn man die Möglichkeit auch wirklich ergreift, die erschwerte Finalisierung tatsächlich ins Ziel zu bringen: Zum rechten Zeitpunkt aus 2,37m nur mithilfe seines Arms ein bestimmtes, 8mm großes Feld treffen. Durch diese Zwangsläufigkeit entsteht eine spezielle Situation: Ähnlich wie in einem Elfmeterschießen kann jeder Wurf gleichbedeutend für Sieg oder Niederlage sein und es gibt nur ein Treffen oder ein Verfehlen – nichts dazwischen.

Stellen Sie sich also vor, sie stehen dort alleine, nur auf sich selbst gestellt. Drei kleine, dünne Pfeile in ihrer Hand. Ein Feld, das so schmal ist, dass nur eine halbe 1 Cent-Münze reinpassen würde. Und jeder Wurf ist ein Drahtseilakt zwischen Erfolg und Misserfolg, zwischen Exzellenz und Versagen. Denn die physische Bewegung ist nicht etwa eine, in der sich die angesammelte Anspannung entladen kann, sondern eine äußerst filigrane, in der schon kleinste Impulse zum Verfehlen des Ziels führen können. Dieser Tanz auf Messers Schneide ist allerdings schon von Vornherein strukturell im Spiel angelegt – man muss sich nur die Konzeption des Dartboards ansehen. Die Felder mit den höchsten Punktzahlen, die vornehmlich anvisiert werden, sind umgeben von Feldern mit den niedrigsten Punktzahlen. Somit bringt das Strecken nach dem Maximalen auch immer eine maximal mögliche Fallhöhe mit sich. Man könnte fast sagen: Es ist ein schmaler Draht zwischen Exzellenz und Versagen.
Die Architektur des Spiels ist also verständlich und berechenbar, die Bedingungen sind immer gleich – und doch geht von der Rolle des Psychologischen im Dart-Wettkampf eine gewisse Unerklärlichkeit und Unberechenbarkeit aus:
„I could probably write a book about this game – I’ve had 23 years in darts and still don’t understand it!“ – Raymond van Barneveld
Einerseits gibt dieses Zitat des 5-maligen Weltmeisters einen Eindruck von der Wirkmächtigkeit des Seelischen im Dart-Wettkampf und gleichzeitig ist es auch ein Ausdruck davon, wie schwer es ist, einen bewussten Zugang zum Erleben zu bekommen, geschweige denn Erklärungen der dahinterstehenden Zusammenhänge aufzustellen.
Ein Blick hinter die Kulissen des Dart-Wettkampfs
Um diese Unerklärlichkeit aufzulösen, müssen wir die dahinter liegenden Zusammenhänge verstehen. Bisherige Studien artverwandter Sportarten geben Hinweise für das Verstehen einzelner Zusammenhänge. Sie konstatieren vor allem, dass sich der Druck entscheidender Spielmomente und Faktoren wie Angst tendenziell negativ (Dolder et al., 2020) sowie Faktoren wie Selbstvertrauen, ermutigende Selbstgespräche und moderate Entspannung eher positiv auf die Leistung im Wettkampf auswirken (Woodman & Hardy, 2003; Aliasghary, M. et al., 2009; Laborde, S. et al., 2021). Eine Studie von Daugs et al. (2000) zeigt, dass das Zeitfenster des richtigen Zeitpunkts des Loslassens so gering ist, dass er an die Grenze menschlicher Nervenleitgeschwindigkeit stößt. Jeder Wurf variiert minimal, da ungewollte Mikro-Kontraktionen im Zusammenspiel von Nervenimpulsen und Muskulatur auftreten – ein sensorisches Rauschen, das die Verlässlichkeit der Würfe beeinträchtigt und nur reduziert, aber nie vollständig verhindert werden kann. Hier kommt die Kovariation ins Spiel: Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheiten verbessert die Präzision nur bis zu einem gewissen Punkt, da das Rauschen weiterhin stört. Entscheidend ist die Fähigkeit des Menschen, Fehler eines Parameters durch die Anpassung eines anderen auszugleichen – etwa eine langsamere Wurfgeschwindigkeit durch ein späteres Loslassen. Dieser unbewusste Prozess des synchronen Anpassens mehrerer Parameter ist die Grundlage für die auftretende Wurfpräzision, zu der Menschen fähig sind. Es scheint also fast so, als müsse man die Präzision gar nicht erwirken, sondern sie eher zulassen und der Kovariation erlauben, die Feinjustierung des Wurfes in eigener Regie zu handhaben (Daugs et al., 2000). Um dies in einem größeren Bild zu untersuchen, wurde mithilfe der morphologischen Psychologie ein tiefenpsychologischer Zugang zum Erleben des Dart-Wettkampfs hergestellt und somit ein Einblick in die dahinter liegenden psychologischen Wirkungszusammenhänge ermöglicht. Wesentlich war dabei eine ganzheitliche Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes losgelöst vom Einzelnen, der als Medium bloß den Zugang zur Erlebenswelt des Dart-Spielens eröffnet (Fitzek & Salber, 1996, S. 116). Um die zugrundeliegenden Wirkungszusammenhänge genauer zu betrachten, wurden neun tiefenpsychologische Interviews mit leistungsorientierten Dartspielern durchgeführt. Die Interviews erstreckten sich über circa zwei Stunden und ermöglichten ein tiefes Eintauchen in die Erlebenswelt des Dart Spielens im Wettkampf (Salber, 2016, S. 103). Diese Beschreibungen wurden im Anschluss in Interviewbeschreibungen zusammengefasst (Fitzek, 2010), in einer Vereinheitlichenden Beschreibung strukturiert und in einem Hexagramm geordnet in Wirkungszusammenhänge gebracht. Hierbei wurden herausstechende Zitate verdichtend rekonstruiert, um psychologische Themenkomplexe des Wirkungsraums festzuhalten (Salber, 2016, S. 18). Der Logik des Hexagramms folgend werden die Ergebnisse in Form der einzelnen Spannungsverhältnisse präsentiert und anschließend im Hinblick auf die Grundqualität als wiederkehrendes, übergeordnetes Bild erläutert.
Spielerische Leichtigkeit in der drückenden Bedeutsamkeit bewahren
An sich ist das Dart Spielen erstmal geprägt von freudiger Leichtigkeit, in der frei und offen, simpel und intuitiv das Spiel als solches aus einem selbstverständlichen Gefühl heraus gespielt wird. Jeder Dartwurf führt in eine kindliche Spielfreude und folgt dem lustvollen Drang, die ausgeprägte Kontrolle der Hände beim Werfen zu spüren. Dies ist erstmal geprägt von einer Selbstverständlichkeit und einem Nicht-Hinterfragen: Man fokussiert sich auf das Ziel und fasst den Pfeil intuitiv an, ohne darüber nachzudenken:
„Der Rest passiert eigentlich automatisch. Ich gucke dann nicht, ob ich den jetzt richtig halte oder mein Arm auf der Höhe ist, sondern es ist dann mehr aus dem Automatismus und aus dem Gefühl.“
Fängt man nun an, sich bewusst damit zu beschäftigen, wie man den Pfeil eigentlich jetzt gerade genau wirft, verschiebt sich der Fokus von einem intuitiven Werfen zu einem bewussten Kontrollieren-Wollen. Genau da zeigt sich die Tücke im Detail. Die spielerische Leichtigkeit wird im Erleben des Dartspielens durch die Zuspitzung der Bedeutsamkeit des Wurfes kontrastiert, die diesem banalen Spielen eine auf einen Punkt gebündelte Bedeutung aufbürdet. Der Druck eines gesamten Spiels bündelt sich zwangsläufig in einem einzigen Wurf:
„Aber am Ende musst Du halt das Doppel treffen. Da geht nichts drumherum und eigentlich spitzt sich alles darauf zu. Also das Gewicht von diesem einen Dart, der drin sein muss, ist größer als das Gewicht aller anderen Darts, die davor geworfen wurden.“
Das unbeschwerte Fühlen des Darts, die Leichtigkeit geht schnell verloren, wenn man dem intuitiven Gefühl aus einer Unsicherheit heraus nicht mehr ausreichend vertraut und ein Drang nach Kontrolle entsteht. Die Kunst des Dart Spielens liegt darin, beim Werfen dem Gefühl zu vertrauen und explizit im entscheidendsten Moment des Spiels den Drang nach Kontrolle loszulassen, um die größtmögliche Kontrolle über das Ergebnis zu haben. Sobald die zugespitzte Bedeutsamkeit des Wurfs die spielerische Leichtigkeit überformt, misslingt der Wurf.
Das Spiel mit sich selbst zwischen Selbstdarstellung und Abschottung
Dartspielen bietet die Möglichkeit, sich ins Rampenlicht zu stellen. Dabei gerät vor allem das Außergewöhnliche bis zu Verrückte in den Vordergrund. Daraus entsteht eine herausgehobene Verkörperung des Eigen-Seins. Diese Individualisierung zeigt sich ebenso in Haltung, Technik und sogar Konstruktion des Wurfgeräts. Jeder spielt einen eigenen Dart, hat sein eigenes Dart-Shirt und seinen eigenen ‚verrückten‘ Spitznamen. In Spannung zur lustvollen Selbstdarstellung zeigt sich ein abschottendes Für-sich-Sein. Beim Wurf muss man ganz in seinem Tunnel sein, trägt die volle Verantwortung und darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen:
„Ich gucke auf meine Darts und ich gucke gar nicht wirklich darauf, was der Gegner macht. Wenn ich darauf achte und dann sehe, der Gegner wirft schlecht, oder er wirft gut, beeinflusst es mich selber.”
Das 1-gegen-1 im Dart bringt Spieler:innen in ein Wechselspiel aus fokussierter Wirksamkeitserfahrung und abgeschotteter Fremdbestimmtheit. Um auch in den passiven Phasen Wirksamkeit zu erfahren und Einfluss nehmen zu können, dienen sogenannte Mind-Games, meist leichte Geräusche, dazu, den Gegner zu stören und zu verunsichern. Das Abschotten dient dahingegen dazu, sich nicht aus seinem eigenen Fokus bringen zu lassen. Damit geht allerdings auch eine intensivierte Auseinandersetzung mit sich selbst einher, die wie ein Kampf mit den eigenen Gedanken erlebt wird. „Am Ende spielst du halt nur gegen dich selber.“ Dieser innere Diskurs dreht sich dabei explizit um den Glauben an das eigene Können im momentanen Spiel auf Grundlage der bisherigen Würfe. Auch dabei tritt ein Loslassen, vom erschwerenden Müssen zum erleichternden Können in den eigenen Gedanken, heraus. „Die Kunst für mich ist beim Dartspielen: Du musst dir eigentlich jederzeit dein bestes Spiel zutrauen. Du darfst es halt nicht von dir erwarten, dass du es jetzt genau spielst. Und das ist halt so diese Waage, wo du eigentlich immer wieder so ein bisschen balancieren musst.“
Das Bei-Sich-Bleiben hilft Spieler:innen bei der zentralen Aufgabe, sich die Spielerische Leichtigkeit im Übergang zur drückenden Bedeutsamkeit zu bewahren. Dieser Fokus kann allerdings schon durch kleinste Reize irritiert werden: Ein Gefühl der Aura des Gegners, ein Wandel in der Stimmung im Raum oder das Verzögern des Spiel-Rhythmus. Dabei ist es nicht entscheidend für die Wirkung der Irritation, ob diese beabsichtigt war oder nicht:
“Kleinigkeiten können jemanden komplett rausbringen. Dart fällt runter im Wurf. Da denken sich manche Leute: Warum fällt dem da der Dart runter, gerade, wo ich auf die Doppel gehe? Und zack, läuft das ganze Spiel in einer anderen Bahn, und man ist dadurch beeinflusst.”
Präzises Können zwischen Fragilität und rauschhafter Perfektion
Das Dart-Spielen im Wettkampf geht einher mit einem ständigen Wirken zwischen meisterhafter Perfektion und begrenzendem Scheitern. Denn die wesentliche benötigte Fähigkeit, die der Dart-Wettkampf von Spieler:innen abverlangt, ist es, auf den Punkt leisten zu können. Auf dem Weg, dieser Notwendigkeit des Spiels gerecht zu werden, sind Spieler:innen allerdings schon durch die zentrale sportliche Bewegung einer gewissen Variabilität ausgesetzt: “Der Wurf ist immer unterschiedlich” und verändert sich sogar über die Zeit minimal. Auf Grundlage dieser Variabilität der zentralen sportlichen Bewegung werden Spieler:innen zwangsläufig mit der Fragilität und Ungreifbarkeit des eigenen punktgenauen Leistens konfrontiert:
„Dart ist eine extrem fehleranfällige Sportart, wo es auf Kleinigkeiten ankommt. Man muss nur den Ellenbogen einen Zentimeter tiefer haben und schon fliegt der Pfeil ganz woanders hin, als da, wo man ihn hin haben möchte.“
Das Konstrukt der Präzision ist demnach so fragil, dass es jederzeit aus dem Nichts zusammenbrechen kann. In diesen Momenten wird der Dart in der Hand erlebt als „Fremdstück“, mit dem man „das erste Mal auf die Scheibe“ wirft. Die Range des eigenen potenziellen Wirkungserlebens ist beim Dartspielen sehr breit gefächert. Die Momente extremer Schwankungen werden als frustrierend erlebt bis hin zu dem Punkt, dass Verzweiflung und Ohnmacht das eigene sportliche Können grundsätzlich infrage stellen. Weiterhin wird deutlich, dass das präzise Können nicht nur in eine negative Richtung, sondern auch in eine positive Richtung stark beeinflussbar ist. Wiederholt offenbart sich das Wirken einer mächtigen inneren Überzeugung der Spieler:innen, die es vermag, aus dem Inneren heraus Erfolg zu entwerfen und ihn wahrscheinlicher zu machen. Dies wird über eine Visualisierung erreicht, in der man das zu erreichende Ziel in der eigenen Vorstellungskraft als bereits erreicht verbildlicht: „Du musst dir schon während du zielst vorstellen, dass er schon steckt im Board“.
Das fragile Leisten wird durch ein konzentriertes Bei-Sich-Bleiben abgesichert, kann allerdings durch äußere Ablenkung ins Wanken gebracht werden. Spielerische Leichtigkeit ist eine unabdingbare Quelle der Präzision, während die Schwere der Bedeutsamkeit sie hemmt. Der Druck des Wettkampfs kann das fein austarierte Können verzerren – und doch müssen Spieler:innen, um ihr Potenzial wieder abrufen zu können, die Fragilität für den Moment akzeptieren, alle Frustration loslassen und sich auf das Neue fokussieren, um erneut exakt auf den Punkt leisten zu können.
Ausgerüstet mit diesem fragilen Leistungspaket begeben sich Spieler:innen auf eine Jagd nach ekstatischen Momenten der Perfektion, die einen großen Reiz des Dart-Wettkampfes ausmachen. Das angestrebte Maß der Perfektion im Dart-Wettkampf sind Highlights wie ‚180er‘ oder ‚High-Finishes‘, die den “emotionalen Kick” des Rauschhaften ausmachen. Die ‚180‘ ist der mit drei Darts höchstmöglich erreichbare Score und somit eine erstrebenswerte Leistung, wohingegen ein ‚High-Finish‘ noch wertvoller ist, weil es zusätzlich den Leg-Gewinn sichert. Es bezeichnet das Herunterspielen von 100 Punkten oder mehr mit drei Darts, wobei mindestens zwei der drei Pfeile in einem der schmalen Triple- oder Doppel-Felder landen müssen, was es umso herausfordernder macht. Das „erhabene Gefühl, in dem Moment alles richtig gemacht“ zu haben ist ein sehr großer Anreiz, der “Suchtpotenzial” birgt. Spieler:innen erreichen in diesen Momenten eine Annäherung an die Perfektion, die das Streben weiter aufrecht erhält. Doch die Kränkung des Perfektions-Gedankens ist in der Architektur des Spiels schon vorbestimmt, denn es ist jede Aufnahme, wenn sie nicht perfekt ist, immer ein Misserfolg, eine Enttäuschung des erhabenen Gefühls. Die rauschhafte Jagd nach Perfektion hält zwar die Flamme der Leidenschaft für Spieler:innen am Leben, dabei sorgt selbst die beste Annäherung an die Perfektion allerdings nie zu einer Zufriedenheit, sondern trägt immer auch die Kränkung des Perfektions-Gedanken in sich:
“Ich habe acht Perfekte mal gespielt und der neunte ging dann sonst wo hin, und dann habe ich das in zehn Darts gemacht. Das ist auch das Beste, was ich bisher gespielt habe. Es ist ein geiles Gefühl, aber es ist natürlich schon deprimierend. Du weißt zwar, du hast acht Perfekte gespielt, aber hattest halt die Chance auf einen Neuner, bis zum letzten Dart. Das ist dann halt noch mal der negative Nachtritt, der dann noch mal ein bisschen weh tut.”
Loslassen in Zuspitzung
Aus den beschriebenen Spannungen ergibt sich ein übergreifendes Bild des Loslassens in Zuspitzung, das die seelischen Prozesse im Dart-Wettkampf grundlegend erfassen soll. Die Dynamik des Dart-Wettkampfs wird erlebt als Zuspitzung, die einen drückenden Charakter entwickelt, der physisch-psychische Anspannung mit sich bringt:
„Am Anfang ist man immer noch relativ entspannt. Aber sobald es dann in Richtung Aus-Machen geht oder um Gewinnen und Nicht-Gewinnen, da baut es sich dann schon ein bisschen auf und man wird immer noch angespannter.“
Die Anspannung zeigt sich in steigendem Puls, verstärktem Schwitzen und zunehmender Nervosität. Die sich entwickelnde „Zitterhand“ bringt Spieler:innen sogar teilweise dazu, ihre sportliche Bewegung nicht mehr ungehindert ausführen zu können und in der entscheidenden Phase des Spiels, den Wurf unterbrechen und neu ansetzen zu müssen. Die drückende Qualität der Zuspitzung kann auch mit einem tatsächlichen Hinterfragen des eigenen Könnens einhergehen: „Was passiert, wenn ich nicht treffe?“ Diese Verfassung wird empfunden als ein Zustand, in dem man vor innerer Unruhe und Verunsicherung auf „wackligen Knien“ steht. Die immer enger werdende Zuspitzung wird erlebt als „ein Knoten, der platzen muss”, und es “wird dann immer noch ein Knoten mehr rangeschnürt“. Der Moment der Finalisierung wird dabei erlebt als der Endpunkt, in dem sich der gesamte Druck explosionsartig entlädt und man sich fallen lassen kann. In diesem Glücksgefühl “schaltet das Gehirn danach einfach instant runter und dann ist es für diese zwei, drei Sekunden einfach zu Ende und alles ist gut”. In der bis zum Match-Dart sich immer weiter zuspitzenden Anspannung physisch und psychisch eine gewisse Entspannung und Leichtigkeit zu finden und zu bewahren, stellt sich als eine zentrale psychologische Herausforderung im Dart-Wettkampf heraus: „Ein gesunder Mix aus Spannung und Leichtigkeit“, den es fein auszutarieren gilt.
Im Angesicht dieser zunehmenden Anspannung zeigt sich Alkohol als gesellschaftlich akzeptiertes ‚Zaubermittelchen‘ zum Loslassen im Dart-Wettkampf. Spieler:innen beschreiben die auflockernde Wirkung von Alkohol, die dazu führt, dass man “gar nicht in den Kopf reinkommt und einfach los spielen kann“. Im Sinne des Ent-Hemmens, des Loslassens, des Ausgelassen-Seins leistet der Alkohol im Dart-Wettkampf demnach, das verkrampfte, übermäßige Kontrollieren-Wollen zu verhindern. Alkohol bewirkt in diesem Zuge, „diesen Tunnelblick zu kriegen“, und darüber hinaus eine gewisse Selbstverständlichkeit, wodurch „die Hemmschwelle, über irgendwas nachzudenken“ sinkt. Alkohol zeigt sich als eine Art unlautere Abkürzung, eine Erleichterung für die Bewältigung der psychologischen Herausforderungen des Dart-Wettkampfs. Im Rückbezug zu der Rolle der Kneipe in der Entwicklung des Dartsports ergibt sich somit ein Gesamtbild, das die Ausformung des Darts-Events, wie es sich heute zeigt, in Ansätzen zu erklären vermag. Der Oktoberfest-artige Aufbau von Bierbänken, die stimmungsvolle Party-Musik, humorvolle Fangesänge und eben das Trinken von Alkohol: All das ist Ausdruck einer Orchestrierung des Loslassens, des Ausgelassen-Seins, die die Spieler:innen darin unterstützt, den verunsichernden Tanz auf Messers Schneide im Rampenlicht bestehen zu können.
Gerät der Drahtseilakt zwischen Anspannung und Entspannung aus der Tarierung, kann sich aus der gesamtheitlichen Anspannung und Verunsicherung ein Verkrampfen entwickeln als Zustand des Nicht-richtig-Loslassen-Könnens. In der Folge kann es dazu kommen, dass man „den Dart gar nicht richtig loslassen“ kann und ein gewohnter Wurf unmöglich wird. Eine Ursache für die aufkommende Verkrampfung sind misslungene Wurfresultate, die zu Frust führen und unzufrieden machen. Dieser Frust verstärkt wiederum, dass man „im Körper angespannter, im Kopf angespannter, einfach verkrampfter und nicht mehr so locker“ ist. Aus dem Druck des Leisten-Müssens heraus kann es dann geschehen, dass man „zu sehr will und dadurch verkrampft“. Dieses Zu-Sehr-Wollen kann demnach dazu führen, dass die nötige Lockerheit des Wurfes verloren geht und zu einer zusammenziehenden Verkrampfung wird:
„Aber dann denkt er daran, er kann gewinnen und verkrampft dann halt wieder, und dann wird es wieder schwer, und dann lässt er den Dart nicht los. Und dann läuft es halt wieder nicht.“
Dieses Verkrampfen vermag es, das sportliche Können derart stark zu verbiegen, dass man seine sportlichen Fähigkeiten grundsätzlich in Frage stellt: “Wenn man denkt, man kann nicht Dartspielen”. Das beschriebene Phänomen ist in der Tat kein Einzelfall, sondern tritt immer wieder bei Dartspieler:innen jeden Niveaus auf und wird in der Darts-Popkultur teilweise als eine Art Krankheit, ‚Dartitis‘ genannt, pathologisiert. Das physisch-psychische Loslassen wird durch ein zu starkes Kontrollieren-Wollen und Verkrampfen nahezu unmöglich. Die daraus resultierende Blockade des Nicht-Loslassen-Könnens führt zu ungewöhnlich schlechten Wurfergebnissen, die wiederum Anspannung und ein verstärktes Kontrollbedürfnis hervorrufen, wodurch ein sich selbst verstärkender Kreislauf der Blockade entstehen kann.
Durch die Zuspitzung, durch die auf den Punkt gebündelte Bedeutung, durch das Müssen, entsteht ein verstärkter Drang nach Kontrolle, der ab einem gewissen Punkt einer Verkehrungslogik unterliegt: Je mehr man krampfhaft versucht, alles bewusst zu kontrollieren, desto mehr verliert man die eigentliche Kontrolle über den Wurf. Die Kunst des Dartspielens lässt sich hier auf eine vermeintlich einfache Formel bringen: In einem Moment des Müssens den Drang nach Kontrolle ein Stück weit loslassen und dem Können vertrauen. Im Mittelpunkt steht dabei das radikale Ein-Lassen auf den Moment und das befreiende Loslassen des Vergangenen, um das Zukünftige selbstwirksam gestalten zu können. Die seelische Bewegung des Ein-Lassens geht damit einher, vor dem Wurf in eine Art meditativen Zustand der Ruhe zu gehen und sich innerlich zu ‚reseten‘.
Da Misserfolg und Enttäuschung in der Konstruktion des Spiels vorbestimmt sind, wird der eigene Umgang damit zur zentralen Herausforderung. Hier gestaltet der Gegenstand einen Raum, in dem sich die eigene persönliche Prägung spiegeln kann und in dem behandelt wird, „wie labil man ist, wie man mit sich selber umgeht“ und „wie man Kritik und Misserfolge ertragen kann“. Wer sich hier nicht löst, kann in einen Teufelskreis geraten – Frust und Angst erzeugen Druck, der das freie Spiel blockiert. Ein einziger misslungener Wurf, an dem der Geist festhängt, kann so zum Ursprung eines Teufelskreises der Unzufriedenheit werden, in dem man die erlebte Kränkung nicht loslassen kann:
„Zum Beispiel bei der WM habe ich mich wirklich über einen Dart geärgert, und dann war der ganze WM-Tag im Arsch für mich. Und so hat sich das dann auch wirklich über diese 3-4 Tage hinweg gezogen.“
Um allerdings loslassen zu können, ist es notwendig, alles in seinem So-Sein zu akzeptieren, im gleichzeitigen Bewusst-Sein, das So-Werden mitgestalten zu können. Aus dieser radikalen Akzeptanz bildet sich ein befreiendes Loslassen. Ein Gehen-Lassen von allem Anderen, sei es der letzte Wurf, das Spielergebnis, das Verhalten, oder aber die Leistung des Gegners. Dabei geht es für Spieler:innen darum, das „Gefühl ein bisschen rauslassen und loslassen“ zu können. Geschieht dies nicht unbewusst, versuchen Spieler:innen, das Gefühl nochmal ganz bewusst abzulegen, indem sie sich vor dem nächsten Wurf etwas Zeit dafür nehmen, um es für sich abgeschlossen zu haben.
Die entgegengesetzte Umgangsstrategie zum Fest-Halten an dem, was war, ist das radikale Akzeptieren von dem, was ist, das einen zu einem vollkommenen Loslassen befähigt und den Gestaltungsspielraum aufmacht für das, was wird.

Tunnelartiges Verschmelzen in dem Fluss des Spiels
Gelingt das seelische Loslassen in gesteigerter Form, kann es Spieler:innen in eine „Flow“-Verfassung führen, die wie ein „Tunnel“ erlebt wird, in den man sich „reinsteigern“ kann. Es gestaltet sich ein Kreislauf des selbstverständlichen Vorangehens, der einfach immer weiter gehen muss. Diese tunnelartige Verfassung wird durch Facetten wie Gedankenfreiheit, ein tunnelartiges Abschotten und ein Gefühl von Selbstverständlichkeit charakterisiert. Das tunnelartige Abschotten als Grundvoraussetzung für den Übergang in die Flow-Verfassung wirkt wie ein „Schutzschirm”, unter dem man nur das Board und das Feld sieht und „die Umgebung schon so ein bisschen loslässt“. Die Facette der Selbstverständlichkeit wird erlebt, als ob es wie „von allein läuft und man total viel Spaß am Spielen“ hat. Der Übergang in diese seelische Verfassung ist allerdings schwer greifbar und kann nicht erzwungen werden, denn „auch wenn man es bewusst versucht, kommt man da meistens noch nicht rein. Die beschriebenen Charakteristika münden in einem Aufgehen in der Einheit von Dart-Spielen und Empfinden, einem „tunnelartiges Weg-Sein“, einer „Trance“ „auf einer anderen Ebene des Bewusstseins“. Dabei ist man „immer in der Bewegung”, „alles passiert so automatisch“, dass man sich „gar nicht konzentrieren“ muss und es gehen trotzdem alle Würfe in das anvisierte Feld. So wie sich diese tunnelartige Trance charakterisiert, beschreibt sie ein Verschmelzen von Dart-Spielen und Empfinden, von Welt und Ich. In dieser Verwandlung des Verschmelzens, in der es nur den Pfeil, das Board und den Score gibt, gehen Spieler:innen für einen Moment in der Materie Dart auf:
„Du bist halt grade irgendwo anders. Halt irgendwo voll im Material drin. Oder in der Materie besser gesagt. Da ist halt einfach nur Dart.“
Im Hier und Jetzt: Bewusstes Sein als Schlüssel zum Erfolg
Die sich zuspitzende Dynamik des Dart-Wettkampf und seine Bildungsprinzipien verlangen von Spieler:innen ein Loslassen, das sich auf unterschiedlichen Ebenen zeigt. In einem Gewand steht das Loslassen für eine entspannende, enthemmende Komponente, die es im Dart-Wettkampf benötigt. In Bezug dazu lässt sich vermuten, dass das Ausgelassen-Sein und der Gebrauch von Alkohol im Sinne eines Ent-Hemmens ein Loslassen in Zuspitzung, einen Umgang mit den Bildungsprinzipien des Dart-Wettkampfes, erleichtert. So lassen sich die Entwicklung des Dartsports in der Wiege der Kneipe, die Ausformung ausgelassener Lebensstile und der bestehende Konsum von Alkohol im Wettkampf psycho-logisch in einen Sinnzusammenhang bringen. In einem anderen Gewand zeigt sich das Loslassen in dem Kontext, bewusst Kontrolle abzugeben und gleichzeitig damit klarzukommen, dieser Kontrolle nicht mächtig zu sein. Man hat nur begrenzte Kontrolle über den Spielverlauf, über das, was der Gegner in seinem Zug macht, oder auch darüber, inwiefern man seine Leistung abrufen kann. Und – ganz zentral – muss man damit umgehen können, die Kontrolle über das Ergebnis eines Wurfes in dem Moment abzugeben, in dem man den Dart loslässt. Man muss das Geschehene gehen lassen und akzeptieren, um Platz für das Kommende zu schaffen. In dem Moment, in dem der Pfeil die Hand verlässt, müssen Spieler:innen nicht nur physisch den Pfeil loslassen, sondern auch jegliche Gedanken daran, was hätte sein können. Damit geht einher, die Unveränderbarkeit des Vergangenen zu erkennen, es radikal zu akzeptieren und von dort aus der Zukunft den Gestaltungsspielraum zu überlassen.
Betrachtet man die gesammelten Erkenntnisse und die daraus entstehenden psychologischen Herausforderungen des Dart-Wettkampfs lässt sich das Dart-Spiel als etwas charakterisieren, das von Spieler:innen verlangt, es als Spiel im eigentlichen Sinne zu spielen. Sich von Erwartungen freizumachen und sich mit Freude und Leichtigkeit einzulassen darauf, ein bedeutsames Ziel treffen zu können. Dart ist aber auch, nach der Perfektion zu streben und gleichzeitig die dauerhafte Kränkung dieser Perfektion loszulassen und in wiederholter Enttäuschung erneut Vertrauen zu finden. Im Grunde lädt der Dart-Wettkampf Spieler:innen zu einer hartnäckigen Prüfung der Achtsamkeit, des bewussten Seins, ein. Diese Prinzipien lassen sich auch in verwandten kulturellen Disziplinen wie der Kunst des Bogenschießens oder der Samurai-Tradition wiederfinden. Die Überzeugung, dass Präzision nicht nur durch Kontrolle, sondern durch Hingabe und einen natürlichen Flow entsteht. Der perfekte Wurf gelingt nicht durch krampfhaften Fokus auf das Ergebnis, sondern durch vollständiges Aufgehen im Prozess:
„Das Treffen des Ziels geschieht, wenn der Schütze den Schuss vergisst und ganz im Tun aufgeht. Es ist nicht der Wille, der trifft, sondern das Loslassen des Willens.“ (Eugen Herrigel)
Qualitative und quantitative Forschung ergeben ein kongruentes Gesamtbild
Im Hinblick auf die bestehende Forschung ist sichtbar geworden, dass die bisherigen Erkenntnisse bestätigt und darüber hinaus in ein kongruentes Gesamtbild zusammengefügt werden konnten. Dabei zeigt sich der Leistungsabfall in entscheidenden Spielmomenten (Dolder et al., 2020) in Form der drückenden Bedeutsamkeit, aus der sich die Zerbrechlichkeit des präzisen Könnens ergibt. Ein selbstverständliches Selbstvertrauen im Für-Sich-Sein offenbart sich im Dart-Wettkampf als antreibende und erschaffende Kraft, die man mit den bisherigen Erkenntnissen zu Selbstvertrauen und ermutigenden Selbstgesprächen (Woodman & Hardy, 2003; Aliasghary, 2020) verbinden kann. Der positive Einfluss von Entspannungs- und Atemtechniken auf den Umgang mit Wettkampfsituationen (Jones et al., 2009; Laborde et al., 2021) lässt sich in das dem Dart-Wettkampf innewohnende Spannungsverhältnis zwischen Anspannung und Entspannung, das es zu balancieren gilt, einbetten. Zudem konnte die beschriebene Kovariation als zentrale Fähigkeit im Wurf in einen Sinnzusammenhang gebracht werden. Die Wirkung der Kovariation, naturgegebene minimale Verfehlen eines Wurfparameters auszugleichen, lässt die Schlussfolgerung zu, man könne Präzision gar nicht vollends erwirken, sondern müsse sie ab einem bestimmten Punkt ‚nur‘ zulassen und der Kovariation erlauben, die Feinjustierung des Wurfes in eigener Regie zu handhaben (Daugs et al., 2000). Diese Erkenntnis spiegelt sich in dem grundsätzlichen Wirkungszug des Dart Spielens wider. Auf dem Weg in eine drückende Bedeutsamkeit müssen Spieler:innen versuchen, sich das intuitive Werfen aus dem empfindsamen Gefühl zu bewahren. Ein zu starkes Kontrollieren-Wollen führt sie auf einen Irrweg, der in Anspannung und Verkrampfung führen kann, weswegen sie ein befreiendes Loslassen leisten müssen, um dem intuitiven Gefühl den Gestaltungsspielraum zu überlassen und das volle Potenzial abrufen zu können.
Darüber hinaus konnte in Bezug auf die Erkenntnisse von Marlovits (2000) insofern bestätigt werden, dass das im Dart-Wettkampf auftretende tunnelartige Flow-Erleben die beschriebene Verschmelzung von Welt und Ich abbildet. Es beschreibt den Prozess, Eins mit dem Spiel zu werden, indem das pathische Empfinden mit dem Fluss des Dart-Spielens verschmilzt und das gnostische Erkennen und Bewerten weitesgehend zur Ruhe gebettet wird. Dieses Aufgehen in der Einheit von Dart-Spielen und Empfinden kann als die höchste Empfindung des Verschmelzens von Welt und Ich im Dart-Wettkampf angesehen werden.
Neue Perspektiven für sportpsychologische Interventionen
Die skizzierten Erkenntnisse bieten eine Grundlage, um Lösungsansätze im Umgang mit den psychologischen Herausforderungen des Dart-Wettkampfs abzuleiten. Zum einen hat sich gezeigt, dass das Regulieren der gegebenen Anspannung ein wichtiger Faktor im Dart-Wettkampf ist. Hier lassen sich verschiedene Techniken erlernen, um gezielt in bestimmten Situationen entspannend auf die Anspannung einzuwirken. Formen der Meditation oder progressive Muskelentspannung könnten Ansätze sein, um die eigene Erregung auf das für einen selbst optimale Level zu regulieren.
Weiterhin hat die Untersuchung gezeigt, dass der Gebrauch von Alkohol im Dart-Wettkampf, auch auf professioneller Ebene, immer noch teilweise gegeben ist. Hier scheint die zentrale Aufgabe für diese Spieler:innen zu sein, Mittel und Wege für sich zu finden, um das Loslassen und Ent-Hemmen ohne Alkohol zu erreichen.
Eine weitere Ableitung für die sportpsychologische Arbeit ist das Praktizieren einer Achtsamkeit, im Sinne von einem bewussten Sein und einem So-Sein-Lassen. Ein Ansatz, um in eine achtsame Verfassung im Dart-Wettkampf zu kommen, könnte sein, einzelne Sinnesmodalitäten durchzugehen und bewusst zu spüren, was wahrgenommen wird. Im Sinne des VAKOG-Modells können sich Spieler:innen in der Spielvorbereitung oder in den passiven Momenten im Spiel die Fragen stellen, die sie zur bewussten Wahrnehmung eines bestimmten Sinnes und somit in das Jetzt führt. Der kinästhetische Sinn spielt hierbei die größte Rolle, weil genau dieser Aspekt des Gefühls in Bezug auf den Dartpfeil wichtig ist. Eine Dart-spezifische Achtsamkeit würde dementsprechend ein gleichzeitiges Bei-Sich-Sein und Im-Moment-Sein ergeben: Der Dart wird geworfen, trifft das Board, und in dem Moment ist er schon vergangen und kann nicht verändert werden. Der Fokus liegt auf dem nächsten Dart, der eine neue Chance ist und nichts mit dem letzten Wurf zu tun hat.
Es hat sich auch gezeigt, dass die Bildungsprinzipien kein übermäßiges Kontrollieren-Wollen verlangen, sondern vielmehr, den Fokus auf das Wesentliche zu richten und einfach geschehen zu lassen. Übertragen in die Praxis bedeutet das für Spieler:innen, den Fokus auf das anvisierte Ziel und eben nicht auf die Bewertung der Bewegung an sich zu setzen. Eine Interventionsform, die sowohl eine Ent-Spannung als auch ein Bewusst-Sein fördert, ist eine bewusste Atemkontrolle. Dabei kann ein bewusstes Achten auf die eigene Atmung ein Aspekt der Achtsamkeit sein, der Spieler:innen in ein bewusstes Sein im Hier und Jetzt bringt. Gleichzeitig lässt sich das bewusste Atmen einsetzen, um die eigene Ent-Spannung im Wettkampf auf ein angemessenes Level zu kalibrieren. Dabei hat sich die Technik des Slow Paced Breathing in bisherigen Studien (Laborde et al., 2021) als positiv einwirkend auf die Wettkampf-Verfassung bewiesen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich aus den Erkenntnissen der Arbeit ergibt, ist der Umgang mit kleinen und großen Misserfolgen. Die Spieler:innen müssen zwangsläufig mit Fehlern, schlechten Würfen oder Rückschlägen umgehen, sprich: mit der Unzufriedenheit über die eigene Leistung. Spieler:innen müssen lernen, den Blick darauf zu lenken, was man in der jetzigen Situation verändern kann, was also überhaupt in der Macht des eigenen Handlungsspielraums liegt. Bestenfalls sollten Spieler:innen also alles, was da in Zukunft kommen könnte, und alles, was war, loslassen und voll im Hier und Jetzt mit dem Dart-Spielen verschmelzen. Dabei ist es zentral, sich immer nur auf den nächsten Dart und die nächste Aufnahme zu fokussieren. Spieler:innen müssen lernen, die Kränkung schnell loszulassen, gegebenenfalls ihre Erwartung anpassen.
Zudem könnten Spieler:innen sich individuelle Routinen entwickeln, die einen ‚Mindset Reset‘ bewirken. Eine bestimmte Bewegung, die in vorherigen Schritten mit einem Loslassen der belastenden Verfassung und einem ‚Neuanfang‘ verbunden wird. Zum Beispiel ein taktiler Reiz mit der Qualität eines schnellen Paradigmenwechsels könnte ein Mittel für diesen ‚Reset‘ in eine neue Verfassung sein. Um im unsicheren und unwegsamen Dart-Wettkampf Verlässlichkeit und Halt zu finden, könnten Spieler:innen darüber hinaus eigene Routinen für das Training und den Wettkampf entwickeln, die ihnen in gewisser Weise einen festen Ablauf und damit einen sicheren Rahmen geben, innerhalb dessen sich ihr Spiel abspielt.
Ein weiterer zentraler Aspekt im Dart-Wettkampfs ist ein selbstverständliches Selbstvertrauen, das die Kraft hat, Erfolg aus dem Innern zu erschaffen beziehungsweise wahrscheinlicher zu machen. Hier könnten, wie schon in bisherigen Forschungen belegt, ermutigende Selbstgespräche oder hilfreiche Affirmationen angewandt werden, um genau dies zu erreichen. Eine weitere Interventions-Möglichkeit sind in Bezug dazu Visualisierungstechniken, die vor einem Wettkampf oder einem Turnier, aber auch während des Spiels angewandt werden können, um Zielzustände zu verbildlichen und sie bestenfalls in die Realität zu holen. Ein leistungsförderndes Mindset wäre an dieser Stelle, mit einer selbstverständlichen Überzeugung die bestmögliche Zukunft zu entwerfen und die Wirklichkeit dann trotzdem mit Gelassenheit so zu nehmen, wie sie tatsächlich kommt.
Aliasghary, Masoumeh & memarmoghaddam, mojgan & seyyedi, fateme. (2020). The effect of educational self-talk on the duration of quiet eye and the accuracy of throwing darts (Acceptance). 10.22080/jsmb.2019.16023.3090.
Darts Regulation Authority – DRA. (2012). Rule Book. http://www.thedra.co.uk/Rule-Book.html
Die Zeit (2012). Mit den Pubs verschwinden die Pfeile. https://www.zeit.de/sport/2012-07/darts-chaplin-england-pub/seite-3?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Dolder, Dennie & Klein Teeselink, Bouke & Potter van Loon, Rogier & van den Assem, Martijn. (2020). Incentives, Performance and Choking in Darts. Journal of Economic Behavior & Organization. 169. 38-52.
Fitzek, Herbert & Salber, Wilhelm (1996). Gestaltpsychologie. Geschichte und Praxis. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Fitzek, H. (2010). Morphologische Beschreibung. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.). Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (S. 692 – 706). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Laborde, Sylvain & Allen, M. & Borges, Uirassu & Hosang, Thomas & Furley, Philip & Mosley, Emma & Dosseville, Fabrice. (2021). The Influence of Slow-Paced Breathing on Executive Function. Journal of Psychophysiology. 36. 1-15.
Marlovits, A. M. (2000). Das Unmittelbare im Sport: Psychologische Explorationen zum Sporterleben. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
Müller, H., Reiser, M., & Daugs, R. (2000). Untersuchung zur Wirkungsweise unterschiedlicher Trainingsformen beim Wurftraining im Basketball und Entwicklung eines Systems zu deren informeller Unterstützung. BISp-Jahrbuch : Forschungsförderung, 1999, S. 205-211.
Patrick Exner, dartn.de. (2023). Sprüche, Witze & Zitate. Dartn.de. https://www.dartn.de/Sprueche-Witze-Zitate
Paulke, E. (2011). Darts: die Erde – eine Scheibe. Bombus-Verlag. München
Salber, Daniel (2016): Wirklichkeit im Wandel: Einführung in die morphologische Psychologie. Bonn: Bouvier.
Turner, K. (1985). Darts – the complete book of the game. Harper Perennial.
Woodman, T., & Hardy, L. (2003). The relative impact of cognitive anxiety and self-confidence upon sport performance: A meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 21, 443–457.
Autor:in
 Autor: Jasper Thöle
Autor: Jasper Thöle
Ausbildung: B.A. Sportmanagement; M.Sc. Sportpsychologie
Grundberuf: Sportpsychologe & Morphologischer Markt- & Kulturforscher i.A.
Tätigkeitsort: Köln
 Co-Autor: Leonard Kai Fuhlert
Co-Autor: Leonard Kai Fuhlert
Ausbildung B.Sc. Wirtschaftspsychologie; M.Sc. Sportpsychologie
Grundberuf: Sportpsychologe
Tätigkeitsort: Berlin