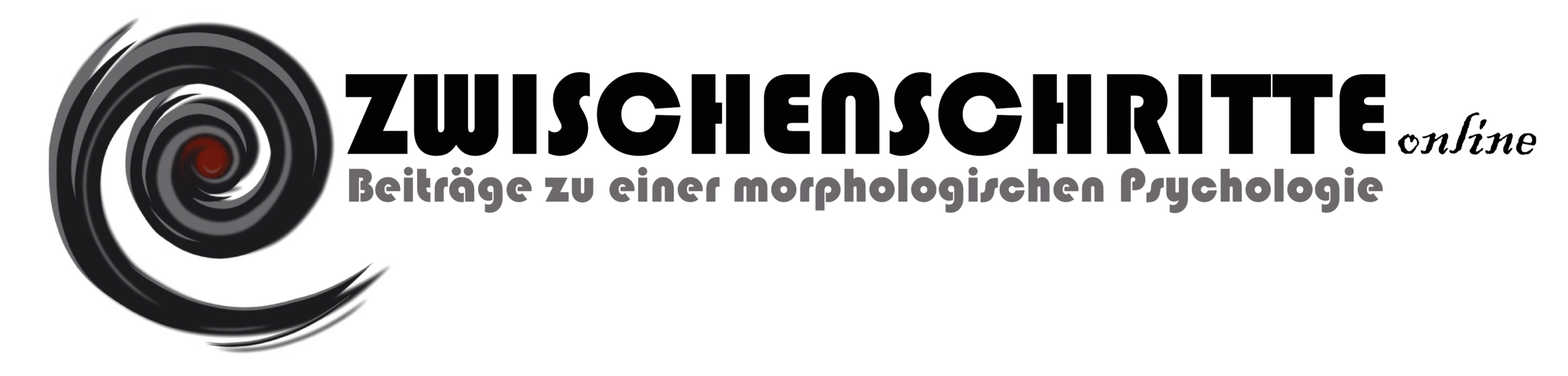„Ziemlich beste Freunde“ – KI zwischen Spiegel und Coach: Warum junge Menschen ChatGPT als emotionalen Gesprächs-partner nutzen – und was das für Marken, Beratung & Gesellschaft bedeutet
Künstliche Intelligenz ist im Alltag vieler Menschen angekommen – nicht nur als Recherche- oder Schreibhilfe, sondern als emotionaler Gesprächspartner. In der Studie „Zwischen Wissen und Empathie – KI der bessere Gesprächspartner?“ von Nicole Hanisch, innerSense Research, und Prof. Dr. Susan Hinterding von der BSP Business & Law School, Campus Hamburg, wurde anhand morphologischer Tiefeninterviews erforscht, wie ChatGPT als Spiegel, Coach oder sogar als Trostspender genutzt wird. Die Ergebnisse zeigen: KI ist nicht länger nur ein Werkzeug, sondern ein sozialer Akteur, der das Kommunikationsverhalten und die Selbstwahrnehmung tiefgreifend verändert. Dieses Whitepaper fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, benennt Chancen und Risiken und zeigt konkrete Anwendungsfelder für Unternehmen, Institutionen und Marken.

Autor:in
Ihre Ansprechpartnerin zur Studie:
Nicole Hanisch
Geschäftsführerin
innerSense research
+49-221-717 948 00
hanisch@innersense-research.com
Über innerSense:
innerSense ist ein tiefenpsychologisches Marktforschungsunternehmen, das sich auf die Analyse von Verbraucherverhalten und der zugrunde liegenden psychologischen Motive spezialisiert hat. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche bietet innerSense fundierte Einblicke in die dynamische Welt des Konsumentenverhaltens.
Durch die Kombination von Tiefenpsychologie und modernsten digitalen Möglichkeiten, unterstützt innerSense Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und erfolgreiche Strategien für Positionierung, Produktentwicklung, Marketing und Markenführung zu entwickeln.
Unser breites Spektrum an Kunden umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Food, Kosmetik, Technik, Handel, Pharma und Medien.
Über Prof. Dr. Susan Hinterding: geboren in Köln, studierte Psychologie und promovierte an der Universität zu Köln. Als Professorin verbindet sie Lehre, Forschung und Praxis mit einem Fokus auf tiefenpsychologische Analysen von Konsumverhalten, Markenwahrnehmung und gesellschaftlichen Trends. Ihre Lehre zeichnet sich durch innovative Didaktik und eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis aus. Gemeinsam mit ihren Studierenden untersucht sie aktuelle Themen wie die Wirkung von Social-Media-Marketing und den Einfluss von KI-Chatbots auf Bildung und Konsumverhalten. Ihre Forschung liefert praxisnahe Einblicke in die Bereiche Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Kommunikation und arbeitet mit qualitativen Methoden, insbesondere der morphologischen Psychologie.
„Ziemlich beste Freunde“ - KI zwischen Spiegel und Coach: Warum junge Menschen ChatGPT als emotionalen Gesprächs-partner nutzen – und was das für Marken, Beratung & Gesellschaft bedeutet
1. Hintergrund & Ziel der Studie
Wir leben in einer Welt permanenter Unsicherheit: Dauerkrisen, digitale Überforderung und gesellschaftliche Polarisierung prägen das Lebensgefühl vieler junger Menschen. Kommunikation wird fragmentierter und wandert immer mehr in den virtuellen, digitalen Raum. Ein direkter Austausch wird emotional anstrengender und ist oft nur schwer auszuhalten. Der Wunsch nach berechenbarer, kontrollierbarer Kommunikation ist groß – KI scheint diesen Trend, der bereits durch SMS, WhatsApp und andere Tools ausgelöst wurde, noch weiter fortzuführen.
Ziel der Studie war es, die emotionalen und psychologischen Nutzungsweisen von ChatGPT im Alltag junger Menschen zu verstehen. Dabei wurde bewusst nicht der funktionale Einsatz, sondern die Beziehung zur KI in den Mittelpunkt gestellt.
2. Methodik
Die Untersuchung basierte auf einem qualitativen Forschungsdesign:
- 78 TeilnehmerInnen im Alter von 18–34 Jahren
- Tiefenpsychologische Interviews nach morphologischem Ansatz
- Gruppendiskussionen, Einzelinterviews, Paarinterviews
- Bundesweite Streuung hinsichtlich Geschlecht, Lebenslage und Bildungsstatus
Die qualitative Anlage erlaubt einen tiefen Einblick in innere Motivationen, Nutzungsdynamiken und emotionale Funktionen der KI.
3. Zentrale Nutzungsformen von KI
Die Analyse zeigt sieben typische Rollen, in denen Menschen ChatGPT erleben:
- Tagträumerisches Gedankenexperiment
ChatGPT wird für absurde Fragen, Horoskope oder Fantasiespiele genutzt. Der Umgang ist spielerisch, fast kindlich – eine Einladung zum gedanklichen Abschweifen. KI wird vermenschlicht, bekommt Spitznamen. Sie dient als Raum für ungefährliche Tagträume.
- Geduldiger Handlanger
Als stille Hilfe bei ungeliebten Aufgaben wird ChatGPT beschimpft, angebrüllt oder abgewertet. Das entlastet die NutzerInnen emotional und dient gleichzeitig der Selbstvergewisserung: „Ich kann das besser.“ Dabei besteht aber auch die Gefahr der persönlichen Kränkung, wenn sich herausstellt, dass es die KI wirklich besser kann!
- Persönlicher Motivationscoach
Die KI gibt Struktur und Motivation für Ziele in Karriere, Fitness oder Alltag. Sie liefert Pläne und To-Do-Listen. Doch oft bleibt die Umsetzung an der Oberfläche – echte Transformation erfordert mehr als generische Tipps.
- Interaktives Tagebuch
Als interaktives Tagebuch hilft ChatGPT beim Gedankenordnen. Die KI strukturiert diffuse Gefühle und bietet sprachliche Klarheit. Aber dabei kann die Reflexion verkürzt und oberflächlicher werden.
- Gefühls-Kompass
In Konflikten, Unsicherheit oder bei schwierigen Entscheidungen dient die KI als neutraler Spiegel: „Sind meine Gefühle berechtigt?“. Sie hilft, Emotionen einzuordnen – birgt aber auch die Gefahr emotionaler Abhängigkeit.
- Mami to Go
Als tröstende, immer verfügbare Instanz wird ChatGPT bei emotionalen Krisen wie z.B. Panikattacken, Stress oder Einsamkeit genutzt. Sie spendet bedingungslosen und „liebevollen“ Zuspruch. Es besteht die Gefahr, dass echte zwischen-menschliche Hilfe ersetzt wird.
- Optimierter Stellvertreter
NutzerInnen füttern die KI mit ihren Gedanken und bekommen eine klarere, bessere Version zurück. Die KI wird zur Erweiterung der eignen Identität – sozusagen ein Co-Pilot des eignen Selbst. Doch: Wenn sie immer besser formuliert, wird die eigene Stimme unsicherer, echte Begegnungen ohne diesen Co-Piloten fallen immer schwerer.
4. Psychologische Dynamik & Bedeutung
ChatGPT ist in den Augen vieler junger Menschen der „bessere Gesprächspartner“:
– immer verfügbar
– nie wertend
– strukturiert, ruhig und empathisch
Doch dieser Komfort hat seinen Preis. Wo Gespräche mit Menschen zu aufreibend werden, rückt KI als Ersatz nach. Dadurch geraten echte Selbstwahrnehmung, Reibung und Entwicklung ins Hintertreffen. Die KI spiegelt zwar, aber sie fordert nicht heraus. Emotionale Prozesse werden abgeflacht, Beziehungen können verlernt werden.
5. Relevanz für Praxis & Gesellschaft
Die Erkenntnisse der Studie haben weitreichende Implikationen für verschiedenste gesellschaftliche und wirtschaftliche Anwendungsfelder. KI wird zunehmend zu einem emotionalen Werkzeug – und beeinflusst dadurch, wie Menschen mit sich selbst und mit anderen umgehen. Einige zentrale Handlungsfelder:
Coaching & Therapie:
ChatGPT bietet eine niederschwellige Möglichkeit zur Selbstreflexion und zur emotionalen Entlastung. Menschen nutzen die KI wie ein interaktives Tagebuch oder eine „digitale Therapeutin“, etwa um diffuse Sorgen zu ordnen oder in Krisen Trost zu finden. TherapeutInnen sollten sich dieser Funktion bewusst sein und reflektieren, wie sie mit KlientInnen im Spannungsfeld von KI-Selbsthilfe und echter Beziehung arbeiten.
HR & Recruiting:
In Bewerbungssituationen oder bei der Persönlichkeitsentwicklung spielt ChatGPT als gedanklicher Sparringspartner bereits eine Rolle. BewerberInnen bereiten sich mit Hilfe der KI auf Interviews vor, formulieren Lebensläufe, reflektieren Soft Skills. Das beeinflusst Selbstbild, Auftreten und Erwartungen. Unternehmen sollten verstehen, wie KI-basierte Selbstwahrnehmung das Recruiting verändert – und wie sie Authentizität in digitalen Zeiten neu bewerten.
Markenbindung & Kommunikation:
KI kann emotionale Beziehungen erzeugen – nicht nur zur Technologie selbst, sondern auch über Umwege zu Marken. Wenn junge Menschen mit der KI über Werte, Lifestyle oder Konsum sprechen, entstehen emotionale Ankerpunkte. Marken, die ihre Kommunikation empathisch und reflektiert gestalten, können davon profitieren. Beispielsweise könnte eine Marke ein KI-unterstütztes Tool bereitstellen, das Jugendlichen hilft, eigene Ziele zu formulieren oder Entscheidungen zu reflektieren – mit Markenbindung als positiver Nebeneffekt.
Bildung & Lehre:
Lehrkräfte sehen sich mit Lernenden konfrontiert, die sich bereits strukturelle Hilfe von ChatGPT geholt haben, bevor sie im Unterricht auftauchen. Hausaufgaben, Projektideen oder Referate entstehen im Dialog mit der KI. Damit verschieben sich Erwartungen und Rollenbilder. Bildungseinrichtungen müssen Wege finden, KI-Kompetenz zu fördern, ohne den Wert des eigenen Denkens und der menschlichen Diskussion zu verlieren.
Familie & Erziehung:
Wenn Jugendliche sagen, „Ich frag lieber ChatGPT als meine Eltern“, stellt das grundlegende Fragen an unser gesellschaftliches Verständnis von Beziehung, Begleitung und Verantwortung. Der Dialog mit einer empathisch programmierten Maschine darf nicht zur Ersatz-Kommunikation werden, wenn es um emotionale Reifung, Konfliktbewältigung oder Entscheidungsfindung geht. Eltern, LehrerInnen und Bezugspersonen sind mehr denn je gefragt, den offenen Dialog mit jungen Menschen zu pflegen – auch, um mit digitalen Co-Piloten mitzuhalten.
6. Chancen und Risiken
Chancen:
- Niedrigschwellige Hilfe bei Einsamkeit oder Orientierungslosigkeit
- Strukturierung von Gedanken
- Entlastung in emotional schwierigen Momenten
Risiken:
- Verlust von Selbsterfahrung und Selbstwirksamkeit
- Abhängigkeit von einem System ohne echtes Verständnis
- Verlernen zwischenmenschlicher Kommunikation
ChatGPT ist mehr als ein technisches Tool – es ist für viele junge Menschen ein stiller Begleiter im Alltag. Die Studie zeigt, dass KI eine emotionale Lücke füllt, die unsere Gesellschaft nicht immer auffangen kann.
Die Herausforderung besteht darin, ihre Stärken verantwortungsvoll zu nutzen, ohne dabei den Kontakt zu uns selbst und zu anderen zu verlieren.
Die Zukunft liegt nicht in der Frage, ob wir mit Maschinen sprechen sollten, sondern wie wir dadurch lernen, besser mit uns selbst und anderen zu kommunizieren.
7. Handlungsempfehlungen: Was jetzt zu tun ist
Basierend auf den Studienergebnissen lassen sich für zentrale gesellschaftliche Akteure konkrete Empfehlungen ableiten:
Für Coaches und TherapeutInnen:
- Thematisieren Sie die Nutzung von KI aktiv im Beratungskontext.
- Klären Sie die Unterschiede zwischen maschineller Spiegelung und echter Beziehung.
- Nutzen Sie hybride Formate, um Reflexion mit digitaler Unterstützung zu fördern.
Für HR & Recruiting:
- Berücksichtigen Sie, dass BewerberInnen KI-Tools zur Selbstinszenierung nutzen.
- Achten Sie auf Authentizität statt Perfektion in Bewerbungsgesprächen.
- Schätzen Sie KI-Kompetenz als neuen Soft Skill.
Für Marken & Kommunikation:
- Entwickeln Sie empathische, dialogorientierte KI-gestützte Tools.
- Inszenieren Sie Ihre Marke als verlässliche Begleiterin im Alltag.
- Nutzen Sie emotionale Insights aus KI-Nutzung für zielgerichtete Kommunikation.
Für Bildungseinrichtungen:
- Fördern Sie frühzeitig kritischen und reflektierten Umgang mit KI.
- Integrieren Sie KI-gestützte Aufgaben in den Unterricht, um Medienkompetenz zu stärken.
- Schaffen Sie analoge Räume für tiefe Gespräche und gemeinsame Reflexion.
Für Eltern & Erziehende:
- Sprechen Sie offen mit Jugendlichen über deren KI-Nutzung.
- Bieten Sie verlässliche, emotionale Gesprächsangebote – trotz Stress und Alltag.
- Vermitteln Sie Werte wie Empathie, Zuhören und Geduld auch im digitalen Zeitalter.
8. Best Practices aus dem deutschsprachigen Raum
Die folgenden Beispiele zeigen, wie KI bereits heute im deutschsprachigen Raum als emotionaler oder reflexiver Gesprächspartner eingesetzt wird:
Coaching & Therapie:
- CoachHub – AIMY: KI-Avatar für Business-Coaching mit echten Dialogen, besonders für junge Führungskräfte.
- KIA – Assistenz für digitale, psychosoziale Beratung
- Jay: Personalisierter Coaching-Chatbot auf Basis von Persönlichkeitsprofilen.
- Mina: Therapie-Chatbot gegen Prüfungsangst bei Studierenden.
- CoachingSpace: Experimentelle Nutzung von ChatGPT für innere Anteile im Selbstcoaching.
HR & Recruiting:
- Deutsche Bahn – DB Smile: Bewerbungsassistent, der empathisch durch Prozesse führt.
- Allianz, Telekom: KI zur Potenzialanalyse und Fairness im Matching.
- CoachHub AIMY: Begleitender digitaler Coach in der Mitarbeiterentwicklung.
Marken & Kommunikation:
- Commerzbank – Bene: Chatbot im Banking mit proaktivem Service.
- Velux: Verkaufsberatung via Chatbot mit individueller Produktempfehlung.
- Handel (z. B. H&M): Stilberatung per Chat mit personalisierten Empfehlungen.
Bildung & Elternarbeit:
- Troodi: Mental-Health-KI für Kinder, die als empathischer Zuhörer dient.
- „KI im Klassenzimmer“: Pilotprojekt mit ChatGPT in Schulen zur Förderung von Reflexion.
- BMFSFJ – Chatbot Familie: KI-Ratgeber für Eltern mit verständlicher Behördenhilfe.
Diese Beispiele zeigen: KI wird bereits erfolgreich eingesetzt, um emotionale Nähe, Struktur und Reflexion zu ermöglichen – und das auf unterschiedliche Weise in Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft.
Fazit:
In allen vier Bereichen – Coaching/Therapie, HR, Markenbindung und Bildung/Elternarbeit – zeigen diese Beispiele, wie ChatGPT und ähnliche KI mehr bieten als reine Information: Sie treten in echten Dialog mit Menschen. Ob als Coach, der zur Selbstreflexion anregt, als Recruiting-Assistent, der einfühlsam durch Prozesse führt, als Marken-Chatbot, der kundenorientiert berät, oder als digitaler Ratgeber in Schule und Familie – KI kann als emotionaler oder reflexiver Gesprächspartner dienen. Diese Projekte aus dem deutschsprachigen Raum verbinden technologische Innovation mit dem Bedürfnis der Nutzer nach Empathie, Verständnis und Interaktion. Die Umsetzung erfolgt teils durch große Organisationen (Konzerne, Ministerien) und teils durch kreative kleinere Initiativen – so entsteht ein breites Spektrum an Erfahrungen, wie KI Vertrauen aufbauen und Menschen unterstützen kann.
Wichtig bleibt dabei stets, die Grenzen der KI zu kennen und sie gezielt als Ergänzung einzusetzen, um das Beste aus beiden Welten – Mensch und Maschine – zu vereinen.

Autor:in
Ihre Ansprechpartnerin zur Studie:
Nicole Hanisch
Geschäftsführerin
innerSense research
+49-221-717 948 00
hanisch@innersense-research.com
Über innerSense:
innerSense ist ein tiefenpsychologisches Marktforschungsunternehmen, das sich auf die Analyse von Verbraucherverhalten und der zugrunde liegenden psychologischen Motive spezialisiert hat. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche bietet innerSense fundierte Einblicke in die dynamische Welt des Konsumentenverhaltens.
Durch die Kombination von Tiefenpsychologie und modernsten digitalen Möglichkeiten, unterstützt innerSense Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und erfolgreiche Strategien für Positionierung, Produktentwicklung, Marketing und Markenführung zu entwickeln.
Unser breites Spektrum an Kunden umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Food, Kosmetik, Technik, Handel, Pharma und Medien.
Über Prof. Dr. Susan Hinterding: geboren in Köln, studierte Psychologie und promovierte an der Universität zu Köln. Als Professorin verbindet sie Lehre, Forschung und Praxis mit einem Fokus auf tiefenpsychologische Analysen von Konsumverhalten, Markenwahrnehmung und gesellschaftlichen Trends. Ihre Lehre zeichnet sich durch innovative Didaktik und eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis aus. Gemeinsam mit ihren Studierenden untersucht sie aktuelle Themen wie die Wirkung von Social-Media-Marketing und den Einfluss von KI-Chatbots auf Bildung und Konsumverhalten. Ihre Forschung liefert praxisnahe Einblicke in die Bereiche Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Kommunikation und arbeitet mit qualitativen Methoden, insbesondere der morphologischen Psychologie.