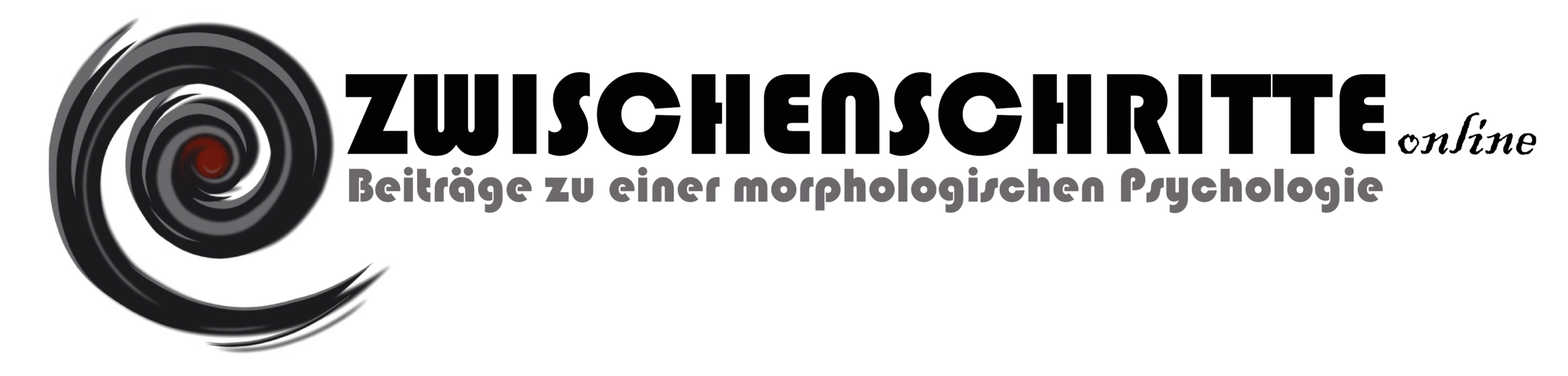Employer Branding am Beispiel der TK
Employer Branding am Beispiel der TK
Einleitung
In Deutschland sind seit einigen Jahren branchenübergreifend Engpässe an Fachkräften zu beobachten. Zu den Ursachen zählen vor allem der demografische Wandel sowie der hohe Veränderungsdruck durch die voranschreitende Digitalisierung. Organisationen stehen vor der Herausforderung, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren und langfristig zu binden (Beek et al., 2015). Einer dieser Wirtschaftsakteure ist die TK. Als Teil des deutschen Gesundheitswesens übernimmt die Krankenkasse die Kosten medizinischer Behandlungen im Krankheits- oder Verletzungsfall (TK, 2022).
Mit diversen Werbekampagnen versucht die TK, dem Personalmangel entgegenzuwirken (Baas, 2019). Ein klarer Fokus liegt auf der Gen Y, die sich durch hohe Technikaffinität, sozialem Engagement und wertebewusster Natur auszeichnet (Hesse & Mattmüller, 2019). Vor dieser Zielgruppe möchte sich die TK vorteilhaft präsentiert. Als zukunftsweisendes Unternehmen steht die TK für fortschrittliche digitale Prozesse, flexible Arbeitsmodelle und Mitarbeiterförderung (Matusiewicz et al., 2019). Dennoch muss auch sie einen Weg finden, die Gen Y erfolgreich anzusprechen. Die Antwort: Employer Branding.
Doch wie muss eine solche Kampagne gestaltet sein, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren? Für die Beantwortung dieser Frage bedarf es einer morphologischen Herangehensweise. Die Methode erlaubt die diversen Erlebensprozesse der Gen Y dynamisch und beschreibend darzulegen (Fitzek, 2017). Der Fokus wird auf bewusste und unbewusste Tendenzen gerichtet. Zu Beginn werden sich aktuelle Studien und Ergebnisse zum Thema angeschaut. Herzstück des Artikels ist die vereinheitlichende Beschreibung. In zwei Versionen wird das vorhandene Datenmaterial spiralförmig ana- lysiert. Es soll eine durchziehende Grundqualität erfasst und Spannungsverhältnisse ausdifferenziert werden. Den Abschluss bilden eine psychologisierende Fragestellung sowie die Diskussion der Ergebnisse.
Employer Branding
Infolge der Bevölkerungsentwicklung hat sich ein neuer Markttyp herausgebildet. Dieser ist stärker an den Arbeitnehmern als an den Arbeitgebern orientiert. Unternehmen haben dadurch nicht mehr den großen Handlungsspielraum früherer Jahre (Hastenteufel & Serena, 2022). Dieses Kapitel präsentiert drei wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Employer Branding. Zunächst wird die Candidate Journey behandelt. Die zweite Studie befasst sich mit Employer Branding während der Corona-Krise. Abschließend werden Erkenntnisse aus schweizer Unternehmen vorgestellt.
Unter dem Begriff Candidate Journey wird der gesamte Prozess bezeichnet, den eine Person während der Bewerbung durchläuft – von der ersten Interaktion mit dem Unternehmen bis zur Mitteilung über die Entscheidung. Sie kann in drei Phasen unterteilt werden. Die „Prägungs- und Orientierungsphase, [die] Bewerbungsphase sowie [die] Auswahlphase“ (Kracklauer & Schill, 2017, S. 9). Die Studie unterstreicht, dass Employer Branding vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des zunehmenden Fachkräftemangels immer relevanter wird. Ein strategisch entwickeltes Employer Branding ermöglicht es Unternehmen, sich gezielt als attraktiver Arbeitgeber bei der relevanten Zielgruppe zu präsentieren. Hierbei wird die Drei-Komponenten-Theorie verwendet, die sich aus den Variablen Markenbekanntheit, Markensympathie und Markenverwendung zusammensetzt. Durch eine gezielt entwickelte Arbeitgebermarke kann ein Unternehmen seine Positionierung bei der gewünschten Zielgruppe stärken und langfristig sichern. Dabei sind auf das Employer Branding einflussnehmende Faktoren die Bekanntheit (kognitiv), die Sympathie (affektiv) und die Attraktivität (konativ) eines Arbeitgebers (Kracklauer & Schill, 2017).
Die Untersuchung zeigt, dass zukünftige Fach- und Führungskräfte Unternehmen vergleichen und auswählen, was die Relevanz eines starken Employer Brandings verdeutlicht. Dies mündet im Falle des Unternehmens Teva ratiopharm in der Auszeichnung als attraktivster Arbeitgeber im Jahr 2017. Durch den Employer Branding-Index lässt sich der Erfolg quantifizieren – er liefert zahlenbasierte Einblicke (Kracklauer & Schill, 2017). Dieser Wert beschreibt die bereits aufgeführte Drei- Komponenten-Theo- rie, die die Anziehungskraft eines Arbeitgebers misst. Teva ratiopharm erreichte einen Index-Wert von 4,09. Zur Ermittlung wird der Median der drei Dimensionen – Bekanntheit, Sympathie und Attraktivität – gebildet. Fünf bildet die Obergrenze. Somit konnte das Unternehmen Teva ratiopharm als Arbeitgeber eine gewichtete Position bei seinem Klientel einnehmen (ebd.).
Dennoch äußern Fach- und Führungskräfte Bedenken. Sie beurteilen die Candidate Journey insgesamt als mangelhaft, da sich der Angebots- zum Nachfragemarkt verschiebt: Es gibt mehr offene Stellen als verfügbare Fachkräfte. Bewerbende haben dadurch mehr Auswahl — während Unternehmen in einen intensiveren Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte treten. (Steinbach 2017). Die Erwartungen der Bewerber haben sich deswegen deutlich erhöht. Transparente Kommunikation über den Stand der Bewerbung ist für Bewerbende von großer Bedeutung. Dies reicht von der Einreichung der erforderlichen Unterlagen bis hin zur Zustellung eines möglichen Ablehnungsschreibens. Mehr als die Hälfte der Bewerbenden erwartet eine Rückmeldung innerhalb eines Monats. Ein durchdachtes und gut umgesetztes Employer Branding ist daher entscheidend für den Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Unternehmen, die ihre internen Prozesse offen und glaubwürdig kommunizieren, fördern das Vertrauen der Bewerbenden und tragen so zur Stärkung ihrer Arbeitgebermarke bei (ebd.).
Die zweite Untersuchung analysiert, ob es in Zeiten wie der Corona-Krise sinnvoll ist, Ressourcen gezielt für Employer Branding einzusetzen oder anderweitig zu nutzen. Dafür wurde sich qualitativer Erhebungsformen bedient. Interviews liefern ausführlichere, gründlichere und umfassendere Beschreibungen der Corona-Krise und der Auswirkungen von Employer Branding (Behring et al., 2023). Die Interviews wurden mit Experten durchgeführt. Es wurde untersucht, ob Ressourcen für das Marketingkonzept aufgewendet werden sollten. Das Ergebnis zeigte, dass Employer Branding besonders in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten mit Ressourcen unterstützt werden muss. Vor allem Mitarbeiter gilt es in einer solchen Situation langfristig an ein Unternehmen zu binden. Ist der akute Problemzustand einer Krise überwunden, müssen Arbeitnehmer angetrieben werden. Gerade Unternehmen können eine solche Situation nutzen, in dem sie ihren Mitarbeitern unterstützend und führend zur Seite stehen. Dieser Synergieprozess stärkt die Arbeitgebermarke, indem das Unternehmen seine Mitarbeitenden in herausfordernden Zeiten unterstützt und ihnen vermittelt, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie ein wichtiger Teil der Organisation sind (Behring et al., 2023).
An der dritten Studie nahmen 2023 insgesamt 585 Schweizer Unternehmen teil: 228 Großunternehmen, 235 mittelständischen Unternehmen sowie 122 Kleinunternehmen. Aus der Studie geht hervor, dass rund 56 Prozent der Unternehmen mit Personalmangel zu kämpfen haben. Für über die Hälfte der Unternehmen besteht die Herausforderung, offene Stellen so zu besetzen, dass der Fachkräftebedarf gedeckt wird. Das Ziel der Studie war es, die Dimension des Fachkräftemangels zu erfassen und Strategien zu untersuchen, um neue Fachkräfte zu akquirieren und bestehende Mitarbeiter zu halten (Merdzanovic et al., 2023).
Employer Branding gewinnt zunehmend an Signifikanz, da Unternehmen auf globalen Märkten mit steigendem Wettbewerbsdruck bestehen müssen. Akteure berichten, dass Vakanzen oft schwer zu besetzen sind. Dies liegt häufig an einer nicht vorhandenen Employer Value Proposition (Merdzanovic et al., 2023, S. 15). Die EVP ist das Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeber. Sie zeigt, was ein Unternehmen einzigartig macht und wofür es steht (Behring et al., 2023). Ein zielgerichtetes Ansprechen potenzieller Arbeitnehmergruppen muss optimiert werden. Eine klar definierte EVP hilft Unternehmen, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Die Studie prognostiziert, dass sich Unternehmen aufgrund des sich abzeichnenden und verschärften Wandels gesellschaftlich verpflichten müssen (Merdzanovic et al., 2023).
Für etwa die Hälfte der Unternehmen ist Employer Branding ein zentrales Mittel, um ihre Arbeitgebermarke zu stärken. Einflussreiche Faktoren sind die Reputation einer Institution (61 Prozent) sowie das Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeitenden (59 Prozent). Dies wird durch ein breites Spektrum analoger Mittel und Ansätze unterstützt, darunter gezielte Stellenausschreibungen und interne Initiativen (ebd.).
Vereinheitlichende Beschreibung
Die vorliegende Untersuchung analysiert eine Employer Branding-Kampagne. Hierzu wird sich auf das Erleben und Verhalten von Arbeitnehmern der Genration Y fokussiert.
Gestaltlogik: Verfallene Idylle
Verfallene Harmonie
Die Gen Y hat aufgrund langjähriger Arbeitserfahrungen Erwartungen an Arbeitgeber entwickelt. Dazu zählt der Wunsch nach einem unterstützenden Arbeitsumfeld, in dem das berufliche Vorankommen gefördert wird. Zentrale Aspekte sind ein „kontinuierliches Weiterbilden“ und wert-schätzendes Feedback. Es muss zielführend und verständlich kommuniziert werden. Der Arbeitgeber sollte ein „offenes Ohr“ haben, wenn es um den „familiären Background“ geht. Geringe „Selbstreflexion“ und „stereotype“ Ansichten wer-den hingegen nicht geschätzt. „Frust“, Stress sowie hohe Arbeitsbelastungen sind uner-wünscht. Das Gefühl kleingehalten zu werden und sich nicht entwickeln zu können ver-stärkt solche Gefühle. Mit diesen dezidierten Arbeitseinstellungen tritt die Gen Y der Kam-pagne gegenüber.
Fördernde Vision
Zu Beginn loben die Probanden die präzise und wirkungsvolle Inszenierung der Kampagne. Sie betonen die Grundprinzipien der TK, darunter ein „attraktive[s] Arbeitsumfeld“, in dem weder übermäßiger Druck noch Stress herrscht. Es werden alle gefordert und gefördert. Die Probanden nehmen einen Arbeitgeber war, der die Stärken und Schwächen seiner Arbeitnehmer kennt und begleitet. Die Unternehmenskultur unterstützt dies durch ihren „Innovations- und Fortschritts – Charakter“, sichtbar etwa in den „Tablets“, der „VR-Brille“ und der „Chat- Kommunikation“. Ansprüche der TK, wie leistungsgerechte Vergütung und Rücksicht auf das familiäre Umfeld korrelieren mit den Erwartungen der Gen Y überein. Die Kampagne erinnert an eine „Matrix[-ähnliche Welt]“ voller Autonomie, Optimierung und Fortschritt, was ein starkes Resonanzempfinden erzeugt.
Wirkungsraum: Verfallen der Vision
Im weiteren Verlauf werden die Spannungszüge des Erlebens weiter ausdifferenziert. Die Darstellung wirkt deutlich „künstlich“. Dem Unternehmensimage mangelt es an Authentizität. Es werden Selbstverständlichkeiten wie flexible Arbeitszeiten und faire Bezahlung angesprochen. Die Inszenierung als „hervorragende und beste“ Krankenkasse erinnert an fragwürdige „Google-Rezensionen“. Der hohe Zufriedenheitsgrad vieler Nutzer soll vermittelt werden. Darüber hinaus verliert die moderne Gestaltung der Kampagne durch abgebildete Strichmännchen-Grafiken und eintönige Musik an Wirkung. Die harmonische Inszenierung zerbricht an ihrer erzwungenen Vollkommenheit.
Bedeutungs(lose) Versprechen
Auffällig an der Kampagne ist der leichte Einstieg sowie die hervorgehobenen positiven Berufsmöglichkeiten. Stilvoll werden leistungsgerechte Vergütung, vielfältige Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung und wertschätzende Arbeitsatmosphäre ansprechend präsentiert. Die Probanden nehmen die artikulierte „Vereinbarkeit von Familie“ und Beruf wahr. Die Kampagne vermittelt ein Arbeitsbild, das den persönlichen Wünschen der Probanden entspricht. Allerdings lassen die Kürze der Kampagne und die eindimensionale Darstellung von Arbeitsnormen bei allen Probanden Irritation zurück. Die TK als innovativer Arbeitgeber setzt auf anschauliche und verständliche Inhalte, statt auf lange und komplizierte Erklärungen. Die schnelle Präsentation von Arbeitnehmervorteilen korreliert mit individuellen Zielen und Interessen der Probanden. Die anfänglich optimierte Selbstinszenierung verliert an Bedeutung.
Zurück(entwickeln)
Die optimierte Selbstinszenierung hat etwas Diffuses an sich. Das abstrakte Umschreiben von Karrieremöglichkeiten als „digitale Treiber“ oder „Kommunikationstalente“ gibt unzu-längliche Einblicke. Der Mangel an eindeutigen und transparenten Berufseinblicken lässt das Konzept haltlos erscheinen. Nur die „zeichentrickartige“ Gestaltung mit ihrem auf-fälligen Design wirkt vertrauenswürdig. Gerade die Stimme des Sprechers und die Ani-mationen bieten Orientierung. Die einfachen und „niedrigschwelligen“ Äußerungen im Vi-deo vermitteln den Probanden das Gefühl, wie Kinder angesprochen und behandelt zu werden. Die TK stellt sich als ein seriöses und zukunftsweisendes Unternehmen mit attraktiven Berufsperspektiven vor. Jedoch führen unpräzise Darstellungen der Arbeitsprozesse dazu, dass berufliche Perspektiven nicht greifbar werden. Das kindliche Design evoziert das Gefühl, zeitlich zurückgesetzt zu werden. Assoziationen an Kitamalerei und -sendungen kommen auf.
(Ent-)fesselndes Führen
Für die Probanden ist eine klare Kommunikation umso relevanter. Routinearbeiten vermitteln besonders Berufsanfängern ein Gefühl von Sicherheit. Eine strukturierte und nachvollziehbare Einarbeitungsphase zu erhalten ist maßgebend. Denn aufgrund fehlender Erfahrungswerte bleiben „Fehlentscheidungen“ nicht aus. Diese liegen außerhalb der eigenen Fähigkeiten. Der Wunsch vertiefend „angelernt und angeleitet“ zu werden ist groß. Leitlinien und Erwartungen sollten klar durch die Führungskraft vermittelt werden. Dennoch kann der Vorgesetzte diese Rolle mit nachteiliger Überheblichkeit ausführen. Ein dominierender Manipulator, der seine Arbeitnehmer wie „Marionette[n] … zu steuern“ versucht. Dies erzeugt das Bild eines profitgetriebenen Arbeitgebers. Im Arbeitskontext bilden verständlich artikulierte Vorgaben und Expertise eine hilfreiche Unterstützung. Bei Fehleinschätzungen oder hektischen Szenen soll eine vertiefte Einarbeitung erfolgen. Allerdings kann der Arbeitgeber ein manipulierendes Erscheinungsbild annehmen. In diesem ist ihm der wirtschaftliche Ertrag vordergründiger als der Arbeitnehmer.
Eigenmächtiges Erweitern
Die Probanden streben nach autonomer Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Sie sehen darin ein Potenzial für kontinuierlichen Wissenserwerb und persönliche Weiterentwicklung. Neue Kompetenzen zu entwickeln und Entscheidungen eigenständig zu treffen, ist ein zentrales Ziel. Doch diese Autonomie kann auch kontrollierende Aspekte zeigen. Die Realität weicht oft von den Erwartungen ab, was ein Gefühl des „Kontrollverlusts“ auslöst. Daher bleiben die erhofften Ergebnisse aus, trotz intensiver Bemühungen. Zwar bleibt der Wunsch, sich neuen Herausforderungen zu stellen, bestehen. Doch mangelt es an Erfahrung, was dazu führt, dass übernommene Verantwortung oft zu Misserfolgen führt. Dadurch entsteht ein verstärktes Bedürfnis, Kontrolle abzugeben. Diese Diskrepanz zwischen Ambitionen und realen Anforderungen verstärkt das Gefühl der Unsicherheit.
Aufnehmen und verwachsen
Weiterhin vermittelt die Kampagne das Bild einer „großen, glücklichen Familie“. Dieses Bild wird von der warmen Grundatmosphäre und dem Wunsch, zur Unternehmenskultur zu gehören, getragen. Ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit, Wertschätzung und Rücksichtnahme wird etabliert. Herausforderungen des Arbeitsalltags werden sich gemeinsam gestellt. Doch trotz dieser positiven Grundhaltung führen fehlendes „Lob“ und unzureichende Kommunikation zu Spannungen und Konflikten. Der Arbeitnehmer fühlt sich übergangen, was Spannungen und Missverständnisse zur Folge hat. Die Kampagne präsentiert das Unternehmen als Familienbetrieb, in den individuelle Beiträge investiert werden. Im Laufe der Zeit verwächst die persönliche Identität mit den Werten des Unternehmens. Allerdings können individuelle Differenzen und die Neigungen des Arbeitgebers zu einem Bruch führen. Eine notwendige Unterstützung bleibt aus, wodurch die Verbindung geschwächt wird.
Einzahlen und bezahlen
Die Probanden müssen Eigenleistung erbringen, um Teil der Unternehmenskultur zu werden. Doch oft bleibt die erhoffte Unterstützung aus. Viele kritisieren, dass ihre Anstrengungen übersehen und andere bevorzugt werden. Das Fehlen von Wertschätzung führt zu dem Gefühl, als „Schuhabtreter“ behandelt zu werden. Folglich wird die übertriebene Selbstinszenierung der Kampagne kritisch hinterfragt. Die Symbolik von Liebe und Zuneigung wirkt auf viele überzogen für einen Arbeitgeber. Individuelle Erfahrungen zeigen, dass Stress und Belastung konstant präsente Faktoren sind. Die Probanden vermuten, dass der Job schöner verkauft wird, als er tatsächlich ist. Im Arbeitskontext steht eine engagierte und zielstrebige Arbeitsweise im Vordergrund. Das berufliche Fördern und die Weiterentwicklung liegen in den Händen des Vorgesetzten. Aufgrund charakterspezifischer Neigungen des Arbeitgebers bleibt dies jedoch aus. Dadurch kommt es zu beruflicher Ausnutzung und Ausgrenzung. Die Kampagne vermittelt hingegen den Eindruck von Harmonie, der in der Realität jedoch schwer nachzuvollziehen ist.
Psychologisierende Fragestellung
Mit dem Rezipieren der Kampagne fühlen sich die Probanden mit ihren Anliegen und Wünschen nach Selbstverwirklichung auf der Arbeit angesprochen. Mit der TK als Arbeitgeber scheinen sich besonders gute Entwicklungsmöglichkeiten zu ergeben. Diese nachgestellte Realität wirkt jedoch etwas unnatürlich. Das Fehlen authentischer Arbeitseigenschaften hinterlässt den Eindruck einer zweifelhaften Selbstinszenierung. Es gelingt nicht, die Kehrseiten und Charakteristika der Arbeit aufzufangen und zu artikulieren. Es gelingt nicht, zentrale Punkte herauszustellen, die grundlegend die Arbeit charakterisieren. Folglich lautet die psychologisierende Fragestellung:
Wie kultiviert das Seelische Erwartungen an potenzielle Arbeitgeber im Angesicht paradiesischer Versprechen?
Fazit
Die Untersuchung verdeutlicht, dass stark idealisierte Employer-Branding-Kampagnen das Potenzial haben, unrealistische Erwartungen und Hoffnungen bei potenziellen Mitarbeitenden zu wecken. Die Darstellung eines nahezu perfekten Arbeitsumfelds greift zwar die Sehnsucht nach Selbstverwirklichung auf, bleibt jedoch einseitig und bietet wenig authentische Einblicke in die tatsächliche Arbeitsrealität sowie in das Unternehmen selbst. Für ein überzeugendes Employer Branding sind greifbare und realistische Elemente von Bedeutung, die die tatsächlichen Herausforderungen der Arbeit widerspiegeln. Kampagnen sollten ein ausgewogenes Bild der Arbeitswelt zeichnen, das sowohl die positiven als auch die anspruchsvolleren Aspekte berücksichtigt. Auf diese Weise lässt sich vermeiden, dass unrealistische Erwartungen entstehen, und ein realistisches Bild der Unternehmenskultur lässt sich authentisch vermitteln.