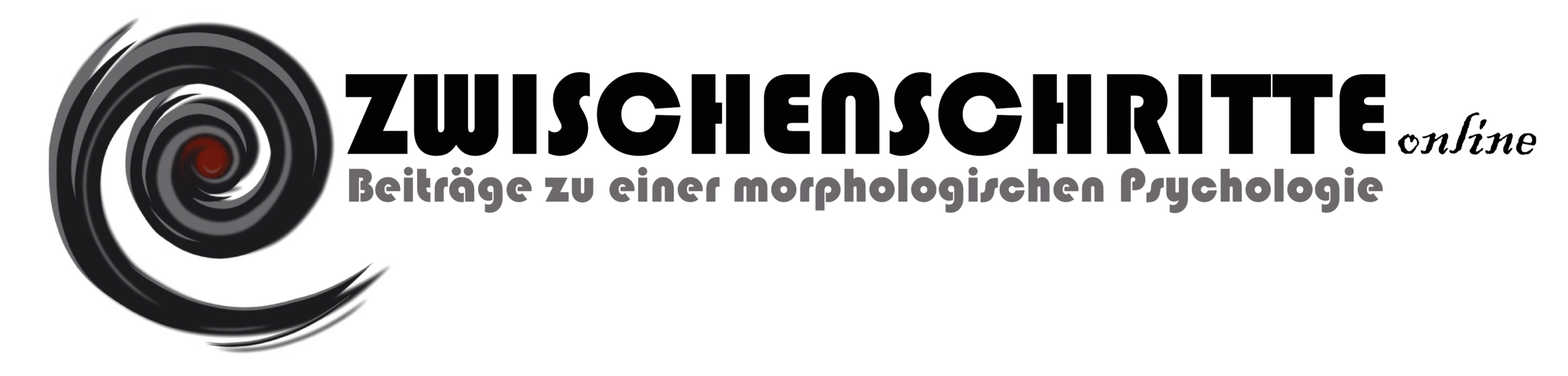Der Deutsche Sport: Vorbild oder Hinterwäldlerin? – Perspektiven Schwarzer Profisportler:innen
Eine morphologisch-psychologische Wirkungsanalyse zum Schwarzsein als Profisportler:in in Deutschland.

Autor:in
Pauline Frimpong Eismann studierte Sportpsychologie (M.Sc.) an der Business & Law School Berlin. Ihr Steckenpferd ist beruflich wie privat der Sport, in dem sie seit über zehn Jahren als Übungsleiterin, Trainerin und studentische Hilfskraft in unterschiedlichen Bereichen mit Kinder und Jugendlichen arbeitet. Sie ist zertifizierte systemische Coachin und widmete sich während ihrer gesamten Studienlaufzeit Diversitätsthemen in ihren Forschungsarbeiten.
Kontakt: pauli.eismann@htp-tel.de
Der Deutsche Sport: Vorbild oder Hinterwäldlerin? – Perspektiven Schwarzer Profisportler:innen
Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik – die Teilnahme daran: wohl ein Ziel für jede:n, der oder die es in den Profibereich schaffen möchte. Ein sportliches Ereignis, welches richtungsweisend dafür ist, welche:r Athlet:in bei den Europa- oder Weltmeisterschaften an die Startlinie treten darf. Hier sollte alles unter professionellen Bedingungen ablaufen, könnte man meinen. Fairness müsste als oberstes Gebot des Sports an erster Stelle stehen. Was jedoch, wenn dies nicht immer der Fall ist? Es geht um eine Athletin, die im Sprintfinale den letzten Platz belegt. Sie bleibt, wie die anderen interviewten Sportler:innen, anonym. Der letzte Platz bedeutet für jede:n mit etwas Menschenverstand, dass die Sportlerin als letzte im Ziel angekommen sein muss. Doch es war anders. Das Zielbild, das mithilfe einer Kamera aufgenommen wird, zeigt deutlich, wer die ersten drei Plätze belegt. Platz vier, fünf und sechs sind jedoch exakt auf einer Linie. Wie kommt die Entscheidung zustande, dass ausgerechnet sie als sechste platziert wird? Die Athletin ist Schwarz. Könnte die Platzierung etwas mit ihrer Hautfarbe zu tun haben? Möglicherweise.
Sportmannschaften, Wettbewerbe, internationale Ikonen: Das Umfeld des Sports scheint auf den ersten Blick keinen Unterschied zu machen zwischen Athlet:innen verschiedener Hautfarben. Häufig wird der Sport als Türöffner in unserer Gesellschaft angepriesen. Er führt laut dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB, 2023), „Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache sowie weiterer Vielfaltsdimensionen“, zusammen. Auch der Deutsche Fußball-Bund (2023) schließt sich dieser Aussage an – „Die Ligen sind stolz darauf zu zeigen, dass der Sport Grenzen überwinden kann.“ Gespräche mit Schwarzen deutschen Athlet:innen zeigen jedoch das Gegenteil. Auch der DOSB (2023) hat noch eine andere Perspektive: „Rassismus ist Alltag für viele Sportler*innen mit Migrationsgeschichte, in allen Ligen und Sportarten, in den Verbänden, in Vereinen, im Breitensport.“ Schafft der Sport es also zu vereinigen oder spaltet er unsere Gesellschaft noch mehr auf?
Darüber wird in Talkshows diskutiert und Betroffene werden für Podcasts interviewt. Regelmäßig werden Schlagzeilen zu rassistischen Übergriffen in Zeitungen veröffentlicht. Im SWR ist zu lesen: „Eine Welle an rassistischen Beleidigungen überrollt den 23-jährigen Mannheimer in den sozialen Medien“ (Fehr, 2024). Es geht um den deutschen Sprinter Owen Ansah, der nicht nur Applaus für seinen neu aufgestellten Rekord erntet. Die Welt berichtet über einen Länderkampf im Boxsport, bei dem Deutschland gegen Südafrika antritt. Dort wird die erste Strophe der deutschen Nationalhymne, welche die Nationalsozialisten missbrauchten, gespielt (Cöln, 2019). Durch die Berichterstattung des Spiegels wird öffentlich, dass die Schwarze Ballerina Chloé Lopes Gomes über ihre Zeit im Staatsballett Berlin preisgibt, immer wieder rassistisch diskriminiert worden zu sein. Beispielsweise musste sie ihre Haut weißen, um einen weißen Schwan tanzen zu dürfen. Eine andere Tänzerin, die die Diskriminierung bestätigt, berichtet: „wenn du in dieser Branche gegen etwas aufstehst, riskierst du deinen Job.“ (von Hof, 2020).
Das Thema Hautfarbe und Rassismus im Sport, mit dem sich Betroffene (zwangsläufig) seit Jahrzenten auseinandersetzen, hat Einzug in unsere Gegenwartskultur genommen. Der öffentliche Diskurs widmet sich Schwarzen Sportler:innen, auch Deutschen. Die Forschung zu Rassismus im deutschen Sport hingegen, befasst sich mit dem Thema in einem sehr geringen Umfang, sodass bislang nur Teilaspekte beleuchtet wurden. Momentan wird eine Studie mit dem Namen „Meritokratischer Mythos? Zum Erleben von Rassismus im Spitzensport“ durchgeführt, die umfassendere Einblicke geben könnte (Dernbach, M. et al., 2024). Für die Studie werden BIPoC-Athlet*innen aus unterschiedlichen Sportarten aus dem Spitzensport interviewt.
Doch bereits 1996 machten die Autoren Alkemeyer und Broskamp auf den Forschungsbedarf aufmerksam. Laut ihnen wird der Hautfarbe im Sport wenig Beachtung geschenkt und zugleich die integrative Wirkung des Sports als selbstverständlich dargestellt. Sie kritisieren, dass die Auffassung, Sport könne kulturelle Grenzen überwinden, den Blick in der Forschung für Fremdheit und Rassismus, verstelle (Alkemeyer & Bröskamp). Die Wirkung der Hautfarbe kreiere häufig Distanz und könne auf Mitspieler:innen und Konkurrent:innen zwischen Neugier, Angst, Abscheu und Ekel bis hin zu dem Eindruck der oder die nicht-weiße Athlet:in sei ein grundverschieden anderes Wesen variieren (ebd.).
Der „Afrozensus“, der die Lebensrealitäten Schwarzer Menschen in Deutschland wissenschaftlich untersucht, fand heraus, dass die sportliche Leistung Schwarzer Menschen „auf angeblich natürliche Begabungen und Fertigkeiten reduziert“ (Aikins et al., 2021) und die individuellen Leistungen so aberkannt und unsichtbar gemacht würden. Bezogen auf den Profisport kann Rassismus in Deutschland am Beispiel des Phänomens Racist Stacking veranschaulicht werden. Ein Schwarzer Torwart in der Deutschen Fußballbundesliga der Herren? Jahrelang gab es keinen. Erst seit kurzem darf der erste Schwarze Torwart nun das Tor des Freiburger FC verteidigen. Die ungleiche Verteilung der Spielpositionen rührt daher, dass BIPoC (Black Indigenous People of Colour) Fußballern eher Spielpositionen zugewiesen werden, die mit „Attributen wie Athletik, Physis, Aggressivität, Schnelligkeit oder Instinkt“ (Nobis et al., 2022) in Verbindung gebracht werden. Im Gegensatz dazu werden Spielpositionen, die mit Intelligenz, Überblick und Kreativität verbunden werden, vermehrt weißen Spielern vorbehalten. Nicht nur die Trainer:innen, die über die Spielpositionen entscheiden, sondern auch die Fans leisten einen Beitrag zur Reproduktion von Rassismus. In Form von rassistischen Beleidigungen, rechtsextremer Propaganda und Hetze, Gesängen und Parolen sehen sich Schwarze Profisportler:innen von Zuschauer:innen konfrontiert. Wobei dieses Verhalten zu großen Teilen im männlichen Profifußball nachgewiesen wurde (Peucker, 2010). Wie sieht es in anderen Sportarten aus? Sind weibliche Profisportler:innen auch derartigem Verhalten ausgesetzt? Und wie erleben die Athlet:innen ihre Hautfarbe selbst? Diesen Fragen gehe ich in meiner Untersuchung auf den Grund. Spoiler: Weibliche Athlet:innen bleiben nicht verschont.
Schwarz und weiß
In diesem Artikel werden die Bezeichnungen Schwarz und weiß in unterschiedlicher Schreibweise verwendet. Grund dafür ist, dass sprachlich in der Regel hervorgehoben wird, wenn eine Person Schwarz ist, aber nicht wenn sie weiß ist, da weiß als Norm in unserer Gesellschaft gilt. Durch die Hervorhebung in Form der Kursivschreibung wird dieses Muster unterbrochen (Hegerfeld, 2024). Schwarz ist eine gesellschaftspolitische Position und politische Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismus, innerhalb einer weißen Mehrheitsgesellschaft, erfahren (Sow, 2015). Schwarz wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass diese Bezeichnung eine Selbstbezeichnung ist, welche von Schwarzen Menschen als Widerstandskonzept entwickelt wurde (Eggers et al., 2005). Im Gegensatz zu Schwarz ist weiß keine politische Selbstbezeichnung und wird deshalb klein geschrieben (Sow, 2018).
Wie wir in „Rassen“ denken
Wohl kaum jemand würde sich selbst als Rassist:in betiteln. Trotzdem findet Rassismus, in unserer gesamten Gesellschaft statt. Im kollektiven Gedankengut besteht das soziale Konstrukt „Rasse“, welches mit biologischen und kulturellen Elementen in Verbindung gebracht wird (Rattansi, 2020). Guillaumin (1995) bringt die Bedeutung von „Rasse“ auf den Punkt: „Race does not exist. But it does kill people“. In dieser Untersuchung, in der es explizit um das Erleben Schwarzer Profisportler:innen in Deutschland gehen soll, wird Anti-Schwarzer-Rassismus eine entscheidende Rolle spielen. Dabei muss Rassismus nicht immer als solcher benannt werden, vielmehr wird aus den Erzählungen bemerkbar, dass er über allem schwebt. Rassismus zeichnet sich dadurch aus, dass er historische Ursprünge hat und ein über die Zeit gewachsenes Phänomen ist. Er führt zu einem Machtverhältnis zwischen zwei Gruppen von Menschen, in diesem Fall „Weißen“ und „Schwarzen“, welches zu ungleicher Chancenverteilung, einem Differenzdenken und einem Herrschaftsverhältnis führt (Barskanmaz, 2020).
In acht psychologischen Tiefeninterviews werden Schwarze Profisportler:innen interviewt, die aus unterschiedlichen Sportarten, wie beispielsweise dem Fünfkampf, dem Boxen oder dem Fußball, kommen. Es werden mehrere Analyseschritte durchlaufen, um dem Untersuchungsgegenstand – dem Erleben der Hautfarbe als Schwarze:r Profisportler:in in Deutschland – immer näher zu kommen. Im ersten Schritt wird ein metaphorisches Bild gezeichnet, welches einen Einstieg in tiefergehende Phänomene ermöglichen soll.
Leidenschaftliche „Fern“- Beziehung
Die Euphorie, die die Autorin zu Beginn und in großen Teilen des Prozesses für den Untersuchungsgegenstand empfindet, scheinen nicht alle zu teilen. Eine Reihe von Interviewanfragen bleibt unbeantwortet und wird abgelehnt, was zu Enttäuschung und Verwunderung führt. Das Nichtauseinandersetzen-Wollen macht früh die abstoßenden Qualitäten des Gegenstandes sichtbar – mögliche Proband:innen möchten mit dem Gegenstand nichts zu tun haben. Verständlich, denn der Gegenstand bringt eine Schwere und Emotionalität mit sich, die nicht zum lockeren Plaudern einladen. Für die Athlet:innen, die ein Interview einwilligen, ist die Autorin eine Fremde, die von ihnen wissen möchte, wie sie ihr Schwarzsein erleben und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Unerhört fühlt sich dieses Fragen nach persönlichen Erfahrungen an. Gleichzeitig wird das Unerhörte nun gehört. Die Stimmen Schwarzer deutscher Profisportler:innen finden Gehör.
Wiederholte Male kommt es vor, dass die Athlet:innen der Schwarzen Autorin das Gefühl geben, sie wisse, wovon sie reden. Durch kollektive Erfahrungen, die Schwarze Menschen machen, setzen die Athlet:innen eine Ahnung der Autorin voraus, durch die Augenhöhe in den Interviews entsteht. Sie können Erlebnisse beschreiben, ohne mit Erklärungen zu unterbrechen. Die erlebte Verbindung lässt anziehende Qualitäten spürbar werden.
Die anziehenden Qualitäten werden auch inhaltlich spürbar indem die Sportler:innen sich durch andere Schwarze Mitspieler:innen willkommen fühlen. Bei Wettkämpfen werden Schwarze Gegener:innen freundlich gegrüßt. Die Sportler:innen schließen mit Schwarzen Teamkammerad:innen enge Freundschaften. Jedoch findet mit dem Anziehen zu der eigenen Gruppe auch ein Abstoßen der anderen, der weißen Gruppe, statt. Stereotype über Schwarze Athlet:innen tragen dazu bei, indem die Athlet:innen aufgrund ihrer Hautfarbe mit hohen leistungsbezogenen Erwartungen konfrontiert werden. Diese können neben negativ behafteten Druck allerdings gleichzeitig zu nützlicher Motivation führen. Einerseits zeigt dies das Leid des Anderssein auf und andererseits tragen diese Stereotype dazu bei, dass die Sportler:innen eine Leidenschaft für den Sport entwickeln. Darauf wird später noch genauer eingegangen.
Trotz der hohen Erwartungen empfinden die Athlet:innen der Sport, zwar nicht nur, aber überwiegend als Raum, in dem die Leistung statt der Hautfarbe zählt. Aus dem Grund betrachten sie den Sport als Sprungbrett und Plattform für den sozialen Aufstieg. Sie lassen sich durch ihr Anderssein, welches auch im Sport nicht gänzlich überwunden werden kann, nicht einschränken. Bzw. das Anderssein schränkt sie im Sport weniger als in anderes Bereichen der Gesellschaft ein, was nicht bedeutet, dass ihre Hautfarbe komplett im Hintergrund steht.
Das Anderssein wird den Athlet:innen Leid, wenn sie merken, dass sie gewöhnungsbedürftig auf ein weißes Publikum wirken. Es wird ihnen Leid, indem sie permanent versuchen, höhere Erwartungen zu erfüllen, aber nicht konstant eine überdurchschnittliche Leistung aufrechterhalten können. Gleichzeitig steht ihr Anderssein eng in Verbindung mit dem Profisport, den sie betreiben. Leidenschaft für den Sport – das verbindet alle Athlet:innen, die ich interviewe – ein Hobby, ein Beruf, eine Berufung, für die man gerne leidet. Das Leid, welches das Schwarzsein im Profisport mit sich bringt, halten die Sportler:innen auf Abstand. Sie halten es entfernt von sich. Hingegen werden Nähe und Beziehung zu anderen Schwarzen Personen bereits aus der Ferne spürbar. Schnell entsteht Beziehung. Das weiße Umfeld im Sport scheint ferner zu sein als das Schwarze. Die Grundqualität Leidenschaftliche „Fern“-beziehung fasst die oben beschriebenen Qualitäten in einem Bild zusammen.
Im nächsten Schritt wird das Erzählte differenzierter betrachtet und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Was geben die Sportler:innen gerne Preis? Was wird immer wieder betont und bereitwillig beschrieben? Darauf wird zuerst eingegangen. Danach soll es darum gehen, was zwischen den Zeilen zu lesen ist. Was verbirgt sich hinter dem Gesagten und lässt sich erst beim genauen Betrachten entschlüsseln?
Hoffen, Kämpfen und Schutz suchen
In den Interviews zeigen sich vordergründig vier Phänomene, die Außenstehenden einen Einblick geben, was die Athlet:innen ganz selbstverständlich beschreiben. Beginnen wir der Reihenfolge nach mit dem ersten Phänomen: Die Athlet:innen weisen, trotz gegenteiliger Erfahrungen, den Einfluss der Hautfarbe zurück.
Schützendes Zurückweisen
“Ich wurde nie wegen meiner Hautfarbe verprügelt“, sagt eine der Sportler:innen. Die Maßstäbe von ihr und anderen Schwarzen Sportlerinnen in Deutschland, davon zeugt ihre Aussage, liegen nicht besonders hoch.
Stundenlang erzählen die Sportler:innen in den Interviews darüber, was sie als Schwarze Profisportler:innen erleben und einige kommen dennoch zu dem Schluss: Hautfarbe spiele meist keine Rolle. Aussagen und Kommentare anderer ließen sie nicht an sich ran oder seien ihnen egal, so sagen die Sportler:innen, einzig der Sport zähle: „Mein Wert ist nicht in meiner Hautfarbe, in meinen Muskeln, in meinem Sport, in meinem Erfolg, in irgendeiner Goldmedaille. Und meine Identität ist auch nicht irgendwie der Sport oder die Hautfarbe.”
Die Athleth:innen messen ihrem Schwarzsein auf den ersten Blick keine Bedeutung bei. Sie weisen es zurück, schieben es weg. Beschreiben sie ihre Erfahrungen aufgrund des Schwarzseins nicht als negativ, besteht für sie keine Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Mit dieser Einstellung kommt der Wunsch nach Veränderung nicht auf und die Athlet:innen befinden sich in keiner ausgelieferten Position – eine Selbstschutzstrategie.
Die Sportler:innen erzählen immer wieder: Die Community im Sport sei sehr offen, Rassismus werde nicht kleingeredet. Sprüche wie „wir brauchen mal wieder ein paar Deutsche im Team“ tun sie als Spaß ab, obwohl die Sportler:innen Deutsche sind. Nie wegen der Hautfarbe verprügelt worden zu sein, sehen sie als lobenswertes Beispiel, statt als selbstverständlich. Einige versuchen die Denkmuster, die Schwarze Sportler:innen wie sie selbst betreffen, zu verstehen: „Meine Mutter [sagt] mir immer in meinen Teams, dass alle gleich aussehen und sie die nicht auseinanderhalten kann, weil die halt alle blonde Haare haben … und dann ist mir das halt mit der Zeit aufgefallen, dass wenn es so rum ist, dann ist es ja bestimmt dann auch andersherum.“
Bestärkendes Anderssein
Das Zusammentreffen mit einer Person, die die gleiche Hautfarbe hat – morgens beim Bäcker, mittags in der Kantine, abends im Fitnessstudio – Was löst das aus? Ist doch ganz normal, oder? Wie fühlt sich dieses Zusammentreffen für Schwarze Sportler:innen in einer mehrheitlich weißen Sportwelt an? Dieser Frage lässt sich durch das Phänomens Bestärkendes Anderssein beantworten.
Anders als im vorigen Abschnitt beschrieben, gewinnt die Hautfarbe nun an Relevanz. Eine Sportlerin erzählt, „man sitzt so zusammen in einem Boot.“ Ein Boot, in dem die Athlet:innen sitzen, weil sie die Hautfarbe verbindet. Das Wort Verbindung ist während der Interviews immer wieder gefallen. Die Sportler:innen erzählen, was sie damit meinen. Sie berichten, eine ähnliche „Leidensgeschichte“ zu haben, zu wissen, wie es sich anfühlt, auf die Hautfarbe reduziert zu werden. Es bedeutet für sie beispielsweise auch, darüber sprechen zu können, wie man seine Braids beim Sport schützen kann. In der Beschreibung der Interaktionen mit andren Schwarzen Sportler:innen schwingen eine zwangslose Lockerheit und Vertrautheit mit, die sich im Alltag wiederspiegelt. Ein Sportler erzählt, wie er spontan von einer anderen Schwarzen Sportlerin einen neuen „Tanzmove“ auf einem Lehrgang gezeigt bekommt. Nach einem Fußballspiel, so berichtet eine Sportler:innen, kommt sie mit einer Schwarzen Gegnerin ins Plaudern. „Beim Abklatschen haben wir dann einfach angefangen zu reden und dann haben wir halt einen Trikottausch gemacht und dann einfach weiter geredet, … also es fühlte sich einfach normal an.“
Das Beisammensein mit anderen Schwarzen führt zu einer Atmosphäre, die einer der Athlet:innen als weniger scharmbehaftet beschreibt. Es sei „ausgelassener“ als wenn weiße Personen mit dabei sind. Die Sportler:innen trauen sich eine Seite von sich zu zeigen, die sie sonst eher verbergen. In anderen Worten: „dann bin ich eher A., der mit den nigerianischen Wurzeln.“
Andersrum, so die Sportler:innen, führe es zu einer Sehnsucht nach „mehr Schwarzen“, wenn man der oder die einzige Schwarze Athlet:in eines Teams ist. Mit einem Schwarzen Team könne man sich mehr wie man selbst fühlen. Eine Sportlerin schwärmt von dem US-amerikanischen WNBA Teams, die aufgrund der hohen Anzahl Schwarzer Spielerinnen besser darin sein, Schwarze zu integrieren. Allgemein sei der Zusammenhalt besser, wenn Mannschaften durchmischter wären, was nicht nur mehr Schwarze, sondern auch mehr POC Mitspieler:innen im Allgemeinen bedeuten würde. Neben Schwarzen Teamkamerad:innen wird sich auch ein:e Schwarze Trainer:in herbeigewünscht. Die Sportler:innen berichten von mehreren Vorteilen, die das für sie hätte. Zum einem hätte diese:r eine Vorbildfunktion, er*sie könnte mehr Verständnis für die Sportler:innen aufbringen und es würde ein anderes Vertrauensverhältnis entstehen. Ein Sportler prophezeit der Autorin: „Wenn du jetzt Trainerinnen und Trainer gehabt hättest im Rudern, die auch light skin gewesen wären, dann hättest du nochmal dreimal überlegt, ob du aufhörst.“
Welche Vorbilder suchen sich die interviewten Athlet:innen, teils schon während der Kindheit? Wenig überraschend sind diese auch Schwarz. Ein Athlet begründet die Wahl: „jeder [hat] das Verlangen danach, geliebt zu werden, gesehen zu werden, respektiert zu werden und das Gefühl entwickelst du, wo du dich mit identifizieren kannst.“ Auch auf der Vorbildebene lassen sich die anziehenden und verbindenden Umgangsformen wiederfinden. Wie eine andere Athletin bestätigt, scheint die Identifikation eine große Rolle zu spielen. Als Vorbild sucht sie sich „andere Leute, … die mich inspirieren, die halt auch irgendwie ein bisschen mehr so zu mir passen und jetzt nicht irgendwelche kleinen, weißen, dünnen Hüpfer.“ Das eigene Empfinden, was sie aus ihrer Kindheit kennen, nehmen die Athlet:innen zum Anlass, sich selbst eine inspirierende Rolle zuzuschreiben. Dadurch könne ein „Kind, was vielleicht in der gleichen Situation ist wie ich, … jung, … kann sich so schlecht mit sich selber identifizieren“, trotzdem eine Motivation für der Sport finden.
Zwischen Trauen und Scheuen, für sich einzustehen
Rassistische Beleidigungen, unfaire Benachteiligung und alleine für sich einstehen müssen: all dies ist auch Alltag der Athlet:innen. Der Sport, den sie selbst als Raum beschreiben, in dem Hautfarbe oft keine Rolle spiele, kann sich auch von einer anderen Seite zeigen. Auch davon berichten die Sportlerinnen. Es steht die Frage im Raum, wie sie damit umgehen.
So viel vorweggesagt: Die Sportler:innen müssen strategisch vorgehen. Eine der Sportler:innen kritisiert ihren Verband, der einen Artikel veröffentlichte, aus dem hervorging, dass Hautfarbe in diesem Verband keine Rolle spiele. Die Krux an der Sache: für den Artikel wurden ausschließlich weiße Personen interviewt. Die gleiche Athletin erhebt auch Einspruch als sie, wie bereits berichtet, bei den Deutschen Meisterschaften „als sechste gelistet“ wird. Sie fragt das Kampfgericht „wieso habt ihr mich auf den schlechtesten gesetzt?“ Schwierig an dieser Situation ist, dass sie den Rassismus, der die Entscheidung des Kampfgerichts möglicherweise beeinflusst hat, nicht beweisen, sondern nur ahnen
kann. Neben dieser subtilen Form zeigt sich Rassismus im Sport auch offensichtlicher. Eine andere Sportlerin erzählt, wie im Training das Spiel „wer hat Angst vorm Schwarzen Mann“ angeleitet wird und sie dem Trainer daraufhin klarmacht: „das ist sehr rassistisch.“
Neben der offensichtlichen Art und Weise, sich zu wehren, wenden die Sportler:innen auch subtilere Formen an. Eine Sportlerin erzählt von rassistische Übergriffen durch den Schlittenbauer, der seine Schlitten an den Deutschen Verband verkauft. Als Reaktion auf sein Verhalten schickte sie ihm nach ihren Olympiasieg den Song „von SXTN ‚Ich bin Schwarz‘“ zu.
Die Entscheidung, wie die Sportler:innen auf Anfeindungen reagieren ist nicht immer leicht. Sie möchten gleichzeitig schlagfertig sein und müssen trotzdem überlegen, welche Reaktion angemessen ist und keine negativen Konsequenzen für sie selbst nach sich zieht. Im Nachhinein wünschen sie sich oft, „dass man auch keine Scheu [hat], so wie ich das in der Vergangenheit hatte, keine Scheu hat, das anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, dass man unfair behandelt wurde aufgrund seiner Hautfarbe.“ Auch schon als Kind hätten sie sich selbst gerne gesagt „du kannst lauter dagegen sein und auch für dich … selber mehr eintreten.“ Wenn sie nun auf rassistische Vorfälle reagieren, überlegen sie strategisch. Einer der Sportler:innen fragt sich, „wenn ich jetzt emotional reagiere, löst das was Positives oder Negatives in der anderen Person aus?“ und ein anderer „sollte ich die Person stellen? Macht es das besser? Macht es das schlechter?“ Mögliche Folgen werden in die Reaktion mit einbezogen, „wenn ich jetzt zurückschreie, freut er sich dann, dass ich mich verliere? Wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, okay, dann sage ich lieber nichts und geh einen anderen Weg.“ Stetig müssen sich die Sportler:innen entscheiden, ob sie sich wehren möchten und den Mut sowie die Kraft dafür aufbringen können oder, ob sie sich zurückhalten und einstecken. Und dafür möglicherweise Energie sparen.
Hoffendes Durchhalten
Es ist ersichtlich geworden, dass die Athlet:innen in ihrem Sportalltag immer wieder mit Rassismus konfrontiert werden. Wie schaffen sie es, trotz der Widrigkeiten am Ball zu bleiben? Sie hoffen, wünschen und träumen. Davon, dass „weiße Menschen sich mehr damit beschäftigen, … dass die halt sich auch mal positionieren und die was dagegen sagen, dass nicht so mir überlassen.“ Sie sollen „mehr an sich arbeiten und reflektieren“ und „mehr auf die Meinung der Menschen hören, die das betrifft.“ Gemeint sind neben jeder*jedem einzelnen vor allem auch Sportinstitutionen, deren Entscheidungsträger:innen verantwortlich sind. Diese sollten „dem Thema, viel, viel, viel mehr Raum“ geben und „klare Kante“ zeigen, um zu vermeiden „dass mein Kind solche traumatischen Erfahrungen einfach macht aufgrund seiner Hautfarbe.“ Dafür ist es notwendig, „dass der Verband damit anders umgeht“, sprich seine „Sportler schützen“ würde. Zusätzlich zu der persönlichen und institutionellen Ebene erkennen die Athlet:innen die Wichtigkeit der gesamten Gesellschaft. Diese müsse verstehen, dass Menschen „Biografien haben, die vielleicht unterschiedlich sind“, aber „alle gleich sind.“ Die Sportler:innen fordern, „es müsste einen Gesamtwandel in der Gesellschaft geben, Akzeptanz, viel, viel, viel, viel, viel mehr sensibilisiert werden, viel, viel mehr.“ Sensibilisierung sollte „ganz gesellschaftlich … im Alltag über Bildung“ stattfinden sowie „in jungen Jahren“ beginnen.
Die Liste der Forderungen und Wünsche ist lang und ließe sich noch fortführen. Trotzdem scheinen die Sportler:innen positive Veränderungen wahrzunehmen, die sie weiterhin hoffen lassen. So berichten sie aus ihrem Sportalltag, „dass schon ein paar Leute … ein bisschen mehr nachgedacht haben, was sie jetzt sagen.“ Sie sind zuversichtlich gestimmt, denn „die Leute wollen ja eigentlich richtig handeln, also die meisten.“ Die männlichen Mannschaften machen Hoffnung, „man hofft ja, dass es dann irgendwann mal so wie bei jetzt den Jungs ist, dass es halt dann diverser wird.“ Gibt es auch Momente, in denen die Hoffnung stirbt?
Von der Selbstermächtigung bis zur Unsichtbarkeit
Nach dem Beschreiben der Hauptbilder wird sich nun den Nebenbilder zugewandt und beschrieben, was den Hauptbilder hintergründig entgegenwirkt. Erzählungen, die den Sportler:innen leicht über die Lippen gegangen sind, sind in Widersprüchlichkeiten verwickelt, die nur durch das genaue Hinhören, Hinterfragen und wiederholtes Beschreiben ans Licht kommen.
Hoffnungsloses Kämpfen und Aufgeben
„Ich vermisse bis heute einfach, dass mal ein klares Statement gemacht wird, dass unsere Nationalmannschaft bunt, divers ist und, dass man einfach trotzdem stolz drauf ist, … das Rassismus keinen Platz hier in diesem Verein hat und erst recht nicht in dieser Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob der Drucker bis heute kaputt ist, aber es gibt bis heute keine Banner, die das aussagen.“
Dem schönen Bild des sich positiv entwickelnden Sportes, dem die Sportler:innen Veränderung zutrauen, wird entgegengewirkt. Das, was die Sportler:innen eigentlich nicht wahrhaben möchten, zeigt sich nun, sodass die langsam Hoffnung stirbt. Eine der Sportler:innen berichtet, dass sie als Aushängeschild für „Integration“ benutzt wird: „dann haben die plötzlich wieder mich die Fahne schwingen lassen von Deutschland.“ Ob tatsächlich etwas gegen Rassismus unternommen wird, hängt von den Sportler:innen selbst ab. Sie sind die Betroffenen und müssen die Probleme trotzdem selbst „aktiv angehen“, da Verbände nicht „selbstständig“ handelten. Die Ursache sehen die Athlet:innen auch darin, dass Rassismus für weiße Menschen „nicht Thema“ sei, „also bei denen ist es ja nicht präsent.“ Sie kritisieren dieses „fehlende Bewusstsein.“
Noch enttäuschter sind die Athlet:innen, wenn es selbst auch aus eigenen Reihen an Unterstützung mangelt. So berichtet eine Sportler:in, dass die „Anti-Rassismus-AG“ von der „Vereinigung Athleten Deutschland“ „in meinen Augen … sehr schwach agiert“ hätte. Es „wird nichts richtig umgesetzt oder nichts Sichtbares für uns Athleten, dass wir das Gefühl haben, wir werden gehört, wir werden gesehen.“
Hintergangen und im Stich gelassen fühlen sich die Sportler:innen. Über das Versagen der Verantwortlichen und der Verbände wird in den Medien in der Regel nicht berichtet. Stattdessen schmücken sich diese mit den Erfolgen Schwarzer Athlet:innen in Deutschland. Die Sportler:innen hingegen stehen alleine mächtigen Strukturen gegenüber. Das zehrt auf Dauer an den Nerven. Die Sportler:innen berichten, „keinen Nerv“ mehr zu haben und „einfach keine Lust, das irgendwie … zu thematisieren, ich weiß, sollte man machen, aber … ich kann das nicht.“ Der Grund dafür: „das kostet immer wieder … sehr viel Energie, die man aufwenden muss, wenn man sich aufregt, wenn man die Person einnordet.“ Eine Athletin gibt zu, „ich hab nachgegeben“, die Aufklärungsarbeit sei „mega anstrengend auf Dauer.“ Sie entscheidet sich dazu, „erstmal nicht“ weiterzumachen. Selbst wenn die Athlet:innen den Mund aufmachen, bleibt dies zu oft erfolglos. Nach einem Vorfall im Trainingslage sprach eine Athletin „mit den Trainern, …. aber ich finde, eigentlich ist nichts passiert.“ Ein Sportler berichtet, in der „Zeit auf der Sportschule hatte ich das Gefühl, das es eigentlich immer gleichgeblieben ist“ und es „keine positiven Veränderungen“ gab – „Als ich klein war, gab es Leute, die Sprüche gehauen haben. Als ich älter war, gab es auch Leute, die Sprüche gehauen haben.“
Ihr Umfeld verhält sich so, dass sich die Athlet:innen nicht mehr trauen, den Mund aufzumachen. Eine der Athlet:innen berichtet: „wurde schon laut am Telefon und dann war ich dann doch sehr eingeschüchtert gewesen und hab dann quasi nicht mehr das Argument gebracht, von wegen, ja ich habe das Gefühl, dass du mich nur aufgrund meiner Hautfarbe, dass du dich gerade gegen mich entscheidest.“
Durch das Ausbleiben positiver Veränderungen tritt ein Gewöhnungseffekt ein – Gewöhnung an Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe – „man wird mit solchen Sachen das erste Mal konfrontiert, … da ist man noch nicht alt genug, um laut zu sein und wenn man alt genug ist, um laut zu sein, da hat man sich schon dran gewöhnt.“ Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass den Athlet:innen der Rassismus nichts mehr ausmacht. Das, was sie erleben, ist unglaublich, auch für sie selbst, kaum zu glauben, „was ich nicht fassen konnte, ist, dass die jetzt deren ganze Wut auf einmal auf die Hautfarbe geschoben haben.“ „Perplex“ ist eine andere Athlet:in, die ihr „Colaweizen“ laut Kellnerin „N***weizen“ nennen soll, „das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt.“
Wenn sich die Athlet:innen trotzdem trauen oder die Kraft aufbringen, Rassismus anzusprechen, sagt man ihnen, „wir meinen das doch nicht böse“ oder die Menschen fühlen sich „angegriffen“ und „ertappt.“ Durch die „Widerstände“ auf die die Athlet:innen stoßen schlussfolgern sie, „diese Diskussion bringt halt nicht so viel.“ Was bleibt, ist „eine dunkle Wolke, … die dir negative Gedanken einfach gibt“ sowie „ein gewisses Trauma, was du einfach mitnimmst und auch wieder in diese neue Saison einfach mit hineinbringst.“
Antreibende Abhängigkeit
Die interviewten Athlet:innen gehörten oder gehören nach wie vor zu den Besten der Besten. Um den Sport auf solch hohen Niveau betreiben zu kommen braucht es eine Menge Ehrgeiz und Disziplin. Das berichten auch die Sportler:innen über sich – „ich war schon sehr ehrgeizig“, „also ich war allgemein immer ehrgeizig, auch im Sport. Ich hab davor rhythmische Sportgymnastik gemacht. Auch alles auch immer auf einem hohen Niveau. Irgendwie war ich schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, nie so, dass ich so Sport einfach so gemacht hab, sondern ich hab schon sehr früh immer gesagt, okay, ich will Olympiasieger werden. Ich will Weltmeister werden.“
Schon früh zeigen sich die ersten Erfolge, „es hat mit 14 Jahren angefangen, dass ich in der Jugend Bundesliga gespielt habe, höherklassig kann man nicht spielen“, erzählt einer der Sportler. Eine andere Sportlerin berichtet, sie sei „schon immer mit an der Spitze“ gewesen. Aber nicht alle, die ehrgeizig sind, schaffen es in den Profisport. Was steckt noch hinter dem Erfolg?
In der Schule wird den Athlet:innen vermittelt, dass eine akademische Laufbahn nicht das richtige für sie sei. Sie erzählen, „ich habe keine Gymnasialempfehlung bekommen, obwohl ich die beste in der Klasse war, weil mein Verhalten nicht gepasst hat.“ Die Laufbahn scheint vorbestimmt zu sein, „ich würde nicht sagen, dass man in der fünften, sechsten Klasse gedacht hätte, … der studiert irgendwann mal.“ Es schien nur der Sport als Ausweg zu bleiben, weil „dieser akademische Weg einfach versperrt ist.“ Im Sport hingegen werden die Sportler:innen zu einer „Person, die … was geleistet hat, was [et]was Besonderes ist.“ Das Besonderssein wird angestrebt, denn „dadurch, dass ich mich anders gefühlt habe, wollte ich besonders sein.“ Außerdem hilft es den Athlet:innen dabei, sich davon zu „lösen, so anders zu sein“, von dem „Schwarzsein … geht der Fokus dann weg, weil ich dann mit was anderem beeindrucken kann.“ Eine Athletin beschreibt, „nicht weil ich Schwarz war, war ich etwas Besonderes, sondern dadurch, dass ich jetzt krass erfolgreich [war].“
Der überdurchschnittliche Ehrgeiz der Athlet:innen wird nun verständlicher, indem sie erzählen, dass „der „Antrieb auch so sehr dadurch bedingt war, dass ich Schwarz bin.“ Ihr sportliches Streben als Kind und Jungendliche:r ist eine unbewusste Strategie, um von ihrer Hautfarbe abzulenken. In dem sportlichen Erfolgen steckt noch eine weitere Bedeutung für die Sportler:innen. Der Sport wird gar zu Überdetermination, in ihn wird ein „Ausweg“ projiziert, „eine Möglichkeit … um irgendwie dem Kreislauf zu entfliehen.“ Er ermögliche den „Eintritt in die Gesellschaft“ sowie „eine Möglichkeit, … an der Gesellschaft teilzuhaben.“ Schlussendlich wird „mit dem Profisport auch ein besseres Leben assoziiert.“ Es verwundert nicht, dass ein Sportler erzählt, er habe einer weißen Person der Erfolg „weniger gegönnt.“ Für die Schwarzen Sportler:innen ist der Sport „unsere Existenz und Identität.“ Als weiße Person, so vermutet es einer der Athlet:innen, säße er wahrscheinlich noch „in Bayern, so in meinem gemachten Nest“ und hätte „Bauingenieurwesen studiert oder bei BMW gearbeitet.“
Ihre sportlichen Ziele tatsächlich umzusetzen schaffen die Athlet:innen durch ihre „Lebensumstände“ – „dadurch, dass wir als Schwarze oft auch nicht so den leichten Weg haben, sind wir … auch so vom Mindset und von der Disziplin und von der Einstellung ein bisschen anders gestimmt und getrimmt.“ Damit ist gemeint, dass sie „offener“ seien, „ein Risiko einzugehen. Also auch meinen Körper aufs Spiel zu setzen, weil ich halt diese Relevanz für jeden kleinen Moment im Sport gesehen habe. Das heißt, wenn ich mich nicht auf den Ball schmeiße, dann gewinnen wir das Spiel nicht. Wenn ich jetzt nicht den Dreier treffe, gewinnen wir das Spiel nicht. Wenn ich jetzt nicht den entscheidenden Pass oder den richtigen Pass spiele, dann gewinnen wir das Spiel nicht.“
Unumgängliche Selbstermächtigung
Dass weiße Menschen mitunter Vorurteile über die Schwarzen Athlet:innen haben oder diese anders behandeln wurde anhand einiger Beispiele geschildert. Aber wie sieht es eigentlich andersrum aus? Und wie denken die Athlet:innen über sich selbst? Durch Interviews, an denen keine weiße Person beteiligt war, kommen interessante Einblicke ans Licht.
Schwarzsein bedeutet für die Sportler:innen „Musikgefühl“ haben und „vom Charakter her einfach anders“ sein. Ein Sportler berichtet, „in gewissen Lebenssituationen fühle ich mich einfach superior als der Durchschnitt.“ Das gilt auch für den Sport. Eine andere Athletin beobachtet, „im Fußball generell merkt man ja oder ich bleibe jetzt mal im deutschen Fußball, … dass es schon sichtlich ist, dass die dominanteren Spieler schon die Schwarzen sind.“ Aber auch global beobachten die Sportler:innen das gleiche, „guck mal auf der Welt, die Sportler, die erfolgreichen Legenden, was für eine Hautfarbe haben die? … Die Basketballer, Michael Jordan, dann Simon Biles im Turnen … , die Boxer alle, Muhammad Ali, Mike Tyson, alle sind Schwarz.“ Es findet eine Glorifizierung Schwarzer Sportler:innen statt und ihnen werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, „wenn die Person auch dunkelhäutig ist, dann hat sie auch diese athletischen Voraussetzungen, dann hat die Person sehr wahrscheinlich auch den gleichen Drive, die gleiche Risikobereitschaft.“
Eine Athletin beschreibt die Wirkung ihres Erscheinungsbildes: „Wenn ich jetzt ein Gegner wäre von mir und gegen mich boxen müsste, einfach nur optisch, hätte ich schon keinen Bock drauf, … es sieht krasser aus, wie wenn da so eine, nicht böse gemeint, aber so eine deutsche Weiße [steht].“
Die Überlegenheit wird durch die „Lebensumstände“ sowie genetische Vorteile begründet. Es sei „sogar biologisch bewiesen, dass Dunkelhäutige genetisch eher dafür veranlagt sind, auch muskulär besser veranlagt sind, schnellere Regenerationszeiten haben.“
Die Athlet:innen werten sich selbst auf, indem sie weiße Athlet:innnen abwerten. Unbewusst scheinen sie die Erfolge weißer Athlet:innen zu verdrängen, um das Bild aufrechterhalten zu können, dass Schwarze Sportler:innen den Weißen überlegen seien. Das Geschehen dreht sich um, indem nun die Weißen von den Schwarzen Leistung abgesprochen bekommen. Außerdem legen die Sportler:innen weißen Menschen ihren Rassismus als Dummheit aus und stempeln sie ab. Sie äußern sich über rassistische Weiße: „what the fuck, dass ihr das nicht wisst“, „sehr unreflektiert“, „lächerlich“ und „sehr dumm oder auch einfach respektlos.“ Abgestempelt werden diese als „Vollidioten“ und Menschen, die „die Welt nicht verstehen und … in einem kleinen Kosmos leben oder aber die Augen vor allem anderen verschließen.“

Ungreifbare Benachteiligung
„Irgendwie kann das nicht mit rechten Dingen zugehen“ – dieses Zitat einer Athletin beschreibt die Gemütslage der Schwarzen Athlet:innen in vielen Alltagssituationen. Als ungreifbare Benachteiligung lässt sich dieses Phänomen betiteln, bei dem die Hautfarbe der Sportler:innen nicht angesprochen wird, aber trotzdem eine Rolle zu spielen scheint. Sie fühlen sich anders und dadurch unwohl und unerwünscht. Warum genau sie anders behandelt werden, ist weder für sie, noch für ihr gegenüber richtig greifbar.
Eine klassisches Beispiel ist die Situation, „wenn Leute einen so ein bisschen länger angucken“, „wenn du den Raum betrittst, die Augen zu dir wandern, also [du] wirklich die einzige Schwarze bist und du von oben bis unten gescannt wirst, das macht was mit dir.“ Entsprechend wird die Hautfarbe auch verbal thematisiert. Eine Athletin wird bei einer Pressekonferenz gefragt, „wie es denn ist, dass ich als erste Schwarze bei den Olympischen Spielen gewonnen hab.“ Neben der ungewollten Aufmerksamkeit, die die Sportler:innen für ihr Schwarzsein bekommen, werden stereotypische Erwartungen an sie gerichtet. Sowohl beim Training als auch bei Wettkämpfen wird das „als Druck empfunden.“ „A., nicht-weiß, der hat die und die Voraussetzungen, der wird das schon machen.“ Ein Athlet erzählt, dass die Erwartungen „ein Grund gewesen [sind], warum ich letzten Endes auch aufgehört habe, … wegen der psychischen Belastung, die dort im Sport präsent ist.“ Die Sportler:innen haben Glaubenssätze wie „ich bin halt Schwarz und ich muss halt in diesem Land doppelt, doppelt so hart arbeiten.“
Negative Erfahrungen im Sport beginnen schon während der Schulzeit, „ich hatte ein kleines BMX und das wurde mir dann irgendwie geklaut, das wurde irgendwie kaputt gemacht, dann wollte ich damit zum Training fahren, die haben sich in den Weg gestellt.“ Der Alltag wird den Sportler:innen erschwert. Das zeigt sich auch daran, dass sportliche Werte wie Leistung und Fairness ins Wanken kommen. Konkret geht um zwei Sportler:innen, die trotz ausreichender Leistung nicht mit zur Olympiaqualifikation genommen werden. Grund dafür: „man wollte unbedingt Athletin XY haben und hat dann halt irgendwie nen Weg gefunden, die auch mitzunehmen.“ Eine weiße Athletin wird stattdessen mitgenommen, was bleibt, ist das Gefühl, „sehr seltsam, nicht erklärlich.“ Die andere Sportlerin berichtet ähnliches: „Erste Quali ist sie gefahren, also hätte sie sich qualifiziert, ich wäre raus. Zweite Quali haben die wieder mich nicht geschickt und die haben mich sogar beschissen. Im Sparring haben die ganzen deutschen Ringrichter mich rausgepunktet, nur die Ausländischen haben für mich gepunktet.“
Niemand spricht offen an, dass die Athlet:innen aufgrund ihrer Hautfarbe nicht mitgenommen werden, „man hat einfach dieses Gefühl, es ist aber nicht greifbar.“ Die Sportler:innen stellen sich Fragen wie, „liegt es auch an meiner Hautfarbe, dass euch irgendwas nicht passt oder, weil … drei Schwarze für Deutschland fahren und dann ist es ein dummes Bild?“ Die Benachteiligung führt, neben psychischer Belastung, zu negativen Folgen für die Karriere der Sportler:innen.
Unbewusstes Abstoßen und Entfliehen
Das Seelische versucht, das Schwarzsein zu verstecken. Damit ist gemeint, dass die Sportler:innen ihr Schwarzsein ablehnen und sich dem Weißsein möglichst annähern. Wie funktioniert das in der Praxis?
Eine Athletin spricht negativ über ihre Schwarzen amerikanischen Gegnerinnen, die „irgendwelche Tänze beim Aufwärmen“ machen und „übelst zurechtgemacht zum Training“ kommen. Beim Erzählen fällt ihr selbst auf „oh man, ne, ich klinge furchtbar, vergiss bitte was ich gesagt hab. Was war die Frage?“ Sie hat unbewusst eine weiße Perspektive angenommen, gegen die sich ihr Inneres zu streben schien. Ein anderer Athlet beschreibt, wie er seiner eigenen Welt entflieht und sich der weißen Welt nähert – seine „besten Freunde waren immer weiß und ich hab immer richtig viel Zeit bei deren Familien verbracht.“ Die Athlet:innen bringen Weißsein in Verbindung mit „in Häusern“ wohnen, „mit dem Auto zur Schule gebracht“ werden und „normal sein.“ Sie vergleichen „diese kleinen deutschen, weißen, blonden Kinder, so süß und zierlich … und ich dann so eine lange Laterne da mitten auf dem Klassenfoto.“
Bei zwei Athlet:innen geht der Wunsch als Kind und bis in das Jugend- bzw. junge Erwachsenenalter, nicht Schwarz zu sein, ins Extreme. Sie möchten „nicht die andere sein, ich wollte halt so dazugehören, wie die sein.“ Im Umkehrschluss bedeutet das „ich hab mein Schwarzsein voll abgelehnt“ und „[mich] immer geschämt“ dafür. Ihrem Freund habe die Athletin anvertraut: „ich fühle mich weiß, aber werde so nicht wahrgenommen.“ Die andere Athletin schafft sich als Kind eine Parallelwelt, in der sie „eine andere Person [ist], aber diese Person, die ich mir immer vorgestellt habe, war auf jeden Fall immer klein, weiß und blond.“ Morgens beim anziehen stellt sie sich vor „es sieht dann süß aus, weil die weiß ist, weil ich bin ja so komisch groß und Schwarz und es würde da nicht so gut aussehen.“ Durch unterschiedliche Strategien versuchen die Athlet:innen dem Schwarzsein zu entfliehen. Dadurch werden alltägliche Schwierigkeiten probiert zu lösen, die sie als weiße Person wahrscheinlich nicht hätten.
Neun Mal komisch
Was verbindet alle neun Haupt- und Nebenbilder? Es ist das Komische. Der Maßstab, nie wegen der Hautfarbe verprügelt worden zu sein und deshalb alles in Ordnung sei, wirkt übertrieben gelassen, fast verblendet, könnte man meinen – komisch. Wenn sich die Sportler:innen als Inspiration keine „kleinen, weißen, dünnen Hüpfer“ suchen, ist das nachvollziehbar, gleichzeitig steckt eine Komik in der Aussage, die das Komische aufzeigt. Trotz traumatischer Erfahrungen bleiben die Sportler:innen dem Sport über Jahre oder sogar Jahrzehnte treu. Auch hier lässt sich das Komische wiederfinden, denn man könnte sich fragen, warum die Athlet:innen dem Sport nicht den Rücken kehren. Seltsam erscheint es, wie die Sportler:innen bei Wettkämpfen platziert werden und wie Entscheidungen getroffen werden, wer mit zu Olympia darf. Gleichzeitig dürfen sie die Flagge von Deutschland tragen, wenn es um „Integration“ geht. Die Doppeldeutigkeit des Sportes macht sich bemerkbar, sie ist nicht nachvollziehbar, nicht greifbar, sondern komisch. Die Bedeutung des Sports für die Sportler:innen ist nicht nur identitätsstiftend, sie ist existenziell. Obwohl der Sport sie nicht immer gut behandelt, sehen sie in ihm den „Ausweg.“ Komisch, auf den ersten Blick, es wird eher nachvollziehbar, wenn man versteht, dass ihnen die Gesellschaft keine anderen (Aus-)Wege anbietet. Im Sport haben die Athlet:innen ein Selbstbewusstsein, welches sie wohl kaum in einem anderen Lebensbereich haben. Einige der Interviewten sehen Schwarze Sportler:innen allgemein als überlegen an, durch ihre Gene, aber auch durch ihre Lebensumstände, die ihnen einen stärkeren Drive verleihen. Interessant und zugleich komisch, welche eine Selbstermächtigung der Athlet:innen im Sport stattfindet. Nicht zuletzt macht es einen stutzig, wenn eine Schwarze Person sich entweder permanent vorstellt, sie wäre weiß oder aber, ihr Schwarzsein leugnet. Es ist komisch und zugleich die Realität einiger Sportstars.
Der Eisenhans
Die erste und zweite Version hat den Gegenstand durch die Beschreibung der Interviews verständlicher gemacht. In der dritten Version wird anhand des Märchens ‚Der Eisenhans‘ eine neue Perspektive auf das Erleben Schwarzer Profisportler:innen in Deutschland eingenommen und weitere Aspekte erkennbar gemacht. Es folgt eine kurze Zusammenfassung des Märchens:
„Ein wilder Mann, der in einem Morast lebt, läßt [sic!] die Jäger des Königs verschwinden. Der König läßt [sic!] den Mann herausholen und in einen Käfig sperren; in diesen Käfig fällt der Spielball des Königssohns. Um den Ball wiederzugewinnen, öffnet er den Käfig, während seine Eltern abwesend sind. Der wilde Mann nimmt den Knaben mit sich in den Wald. Hier muß [sic!] er dreimal darauf achten, daß [sic!] nichts in einen Brunnen fällt – was hinein fällt [sic!], wird golden, auch das Haar des Jungen. Da er die Probe nicht bestanden hat, muß [sic!] er den wilden Mann verlassen. Als Gärtnerjunge verdingt er sich bei einem König, dessen Tochter ihn dreimal zu entdecken sucht. Als Feinde das Land überfallen, ruft er den wilden Mann – den Eisenhans – um Hilfe an; mit Hilfe der Truppen, die der Eisenhans ihm gibt, kann er den Krieg entscheiden. Der Junge gibt sich jedoch nicht als Retter zu erkennen; daraufhin versucht der König, den Retter seines Landes herauszufinden, indem seine Tochter dreimal den goldenen Apfel unter die Ritter wirft. Der Junge fängt den Apfel dreimal, gibt sich aber wiederum nicht zu erkennen – erst die Liebe der Prinzessin entdeckt ihn. Zu seiner Hochzeit kommen die Eltern des Jungen und der von ihm erlöste Eisenhans.“ (Salber, W., 2018)
So wie sich der Königssohn den Anweisungen seiner Eltern widersetzt, indem er die Gefahr sucht und den Käfig öffnet, so widersetzen sich auch die Sportler:innen. Sie widersetzen sich unfairen Platzierungen und nachteilhafter Behandlung. Sie suchen Gefahr, indem sie ein risikoreiches Spiel spielen und suchen zugleich Rettung, wie der Königssohn. Rettung versprechen sie sich durch den angestrebten Erfolg im Sport, den sie mit einem besseren Leben assoziieren. Den Sport nehmen sie als Entwicklungschance und Aufstiegsmöglichkeit wahr. Das Märchen verweist durch die Entwicklungschance des Königssohns darauf, dass die Sportler:innen, so wie der Königssohn, versuchen müssen, keinen Verrat zu begehen. Bei den Sportler:innen bezieht sich das darauf, dass sie weder ihre Schwarzen, noch ihre weißen Mitspieler:innen, Trainer:innen, Fans und Familien verraten sollten. Sie schlagen sich nie gänzlich auf eine Seite. Mal erzählen sie, sie hätten mit Rassismus nicht zu kämpfen und später wiederum, dass sie eine stärkere Verbindung zu Schwarzen Menschen spüren. So wie der Königssohn die Forderungen nicht erfüllen kann, können die Athlet:innen nie die Forderungen erfüllen, die an sie gestellt werden. Und andersrum erfüllen weiße Menschen nicht die Forderungen der Sportler.innen. Das Märchen lehrt, dass ihre Rebellion nur in Maße stattfinden kann, da die Sportler:innen sonst fürchten müssen, in keine Einheit mehr zu passen.
Die Stellungswechsel und Umbildungen sind, so wie im Märchen, auch bei den Sportler:innen selten von Dauer. Nicht ewig schaffen sie es, überlegen im Sport zu sein oder gegen Rassismus zu kämpfen, für sich einzustehen, hoffnungsvoll oder hoffnungslos zu sein. Aber so wie der Königssohn, werden auch sie immer wieder in Kämpfe verwickelt. Ihnen werden Wunden und Schmerzen zugefügt, die zum Wandel drängen. Das bedeutet für die Sportler:innen, gegen Rassismus vorzugehen. Oder aber, so wie der Königssohn sein goldenes Haar zu verstecken versucht, versuchen die Athlet:innen ihr Schwarzsein zu verstecken. Das Verwandlungsproblem wird deutlich, denn keine der Strategien ist von Dauer. Hervor geht ein Dritter. Es entwickelt sich ein:e unangepasste:r erfolgreiche:r Schwarze:r Profisportler:in.
Wie lassen sich Anderssein und Vereinheitlichung vereinen?
Wie die Sportler:innen mit ihrem Schwarzsein umgehen ist nicht individuell. Viel mehr orientieren sie sich (un)bewusst an Lösungstypen, die unterschiedliche Umgangsformen mit dem Spannungsverhältnis, in dem sie sich befinden, aufzeigen. Kein:e Sportler:in lässt sich durchgehend einem Lösungstyp zuordnen, lediglich gibt es Tendenzen. Und keiner der Lösungstypen löst das Paradox zwischen Anderssein und Vereinheitlichung gänzlich auf.
Die Ausblendenden schieben die Bedeutung ihrer Hautfarbe weg und fühlen sich weder benachteiligt, noch sehen sie eine Vorteil durch ihr Schwarzsein. Eine Sportler:in erzählt, „ich achte irgendwie gar nicht darauf, Schwarz, weiß, sind alle gleich, alle Menschen, mir ist es so egal.“ Durch Sprüche zu ihrer Hautfarbe lassen sie sich nicht kränken, „wenn da so ein Spruch kommt‚ Sie sind Schwarz, Sie müssen bestimmt richtig schnell sein“, da hörst du einfach drüber hinweg.“ Wichtig sei ihnen, dass Schwarze Menschen „immer offen, auch anderen Menschen gegenüber“ sind. Das Vorteilhafte dieses Lösungstyps ist es, dass sich die Athlet:innen nicht als anders wahrnehmen und versuchen müssen, sich anzupassen. Sie können sich vollkommen auf den Sport konzentrieren. Das funktioniert allerdings nur so lange, bis es zu einem wirklich einschneidenden Erlebnis kommt, das nicht einfach ausgeblendet werden kann oder als Spaß zu verstehen ist.
Die Verbündeten tun sich mit anderen Schwarzen Menschen zusammen. Mit ihnen können sie auf Augenhöhe sprechen und stoßen auf Verständnis. Ihr Leid können nur Menschen mit „der gleichen Hautfarbe, mit derselben Herkunft und mit demselben Background und Geschichte“ nachvollziehen. Die Verbündeten leben ganz nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Anstatt darauf zu hoffen, dass sie mit weißen Menschen ein besserer Umgang finden, suchen sie sich andere Schwarze. Bei diesem Lösungstyp wird riskiert, dass sich Grüppchen bilden, die untereinander bleiben – „wenn ich jetzt eine Mannschaft von 24 Spielern habe und da haben irgendwie zehn … Migrationshintergrund, die hängen halt nur miteinander ab und machen ihr Ding und haben halt Spaß“, dann entsteht keine Einheit mit der gesamten Mannschaft. Andererseits können Verbündete dazu beitragen, dass die Sportler:innen der Sport überhaupt weiter ausführen.
Die Verteidigenden stehen für sich ein und bemühen sich, über Rassismus aufzuklären, auf rassistisches Gedankengut aufmerksam zu machen und einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Die Leute sollten lernen „dass die Welt eigentlich bunt ist und, dass man … selber nicht so das Problem ist, sondern das Problem“ sind „die Leute, die nicht sehen, dass die Welt nicht nur aus weißen Menschen besteht.“ Das Ziel sei es: „ich möchte etwas verändern, damit ich klarkomme und damit andere Schwarze Menschen im Sport klarkommen.“ Die Herausforderung dieses Lösungstyps ist, dass sich die Athlet:innen eine riesige, nicht lösbare Aufgabe stellen. Irgendwann könnten der Mut, der Tatendrang und die Hoffnung verloren gehen. Eine Sportlerin sagt: „es ist eigentlich scheißegal, was ich mache.“
Die Überlegenen versuchen ihr Anderssein in ein Besonderssein sowie Bessersein umzuwandeln. Dem Schwarzsein, welches sonst eher negativ behaftet ist, geben sie eine positive Konnotation. Sie sind überdurchschnittlich gut in ihrer Sportart und erfüllen das Stereotyp, dass Schwarze Menschen bessere Leistungen im Sport erzielen. Es entwickle sich „so ein Gefühl … immer mehr zu machen, um am Ende des Tages erfolgreicher zu sein.“ Die überdurchschnittliche Leistung verschaffe ihnen Respekt, „was ich öfters auch gehört habe, wenn Leute gegen Schwarze boxen, immer so, ey, ich boxe heute erstes Mal gegen eine Schwarze.“ Die Leistung dient als Schutz davor, zurückgelassen zu werden. Denn die Gefahr sei es, dass „die Leistung nicht mehr zu 100% stimmt und man … verglichen wird, … also du als PoC oder Schwarze Person mit einer [weißen] deutschen Athletin“, die dann bevorzugt wird.
Die Angepassten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich von ihrem Schwarzsein distanzieren und sich dem Weißsein immer mehr annähern. Das funktioniert, indem sie sich „sehr white-passing“ (PoC, die weiß wahrgenommen werden und mehr Privilegien als andere Mitglieder ihrer Gruppe haben) verhielten. Ihr Gedanke: „wenn ich weiß wäre, dann wäre alles so viel einfacher.“ Die Hoffnung der Angepassten ist es, an den Vorteilen, dem Ansehen und dem Gleichsein, wovon weiße Athlet:innen profitieren, teilhaben zu können. Selbst wenn das Schwarzsein nicht gänzlich abgelehnt wird, wird es vorübergehend abgelegt: „ich biege mich quasi immer so, … wie es für mich ein Vorteil ist.“ Durch ihre Anpassung können sie vorbeugen, noch tiefer in eine Schublade gesteckt zu werden, denn sie widersprechen damit den Klischees. Allerdings befinden sich die angepassten Sportler:innen immer in einer Verleugnung ihrer selbst.
Was die Sportpsychologie (nicht) kann
Was Vereine auf struktureller Ebene umsetzen könne ist offensichtlich und dennoch nötig. Dazu zählen Anti-Diskriminierungs-Workshops, Ansprechpartner:innen für Probleme sowie diverses Personal auf allen Ebenen. Sprich, nicht nur diverse Teams, sondern auch Trainer:innen und Entscheidungträger:innen. Diese Maßnahmen führen zu einer besseren Sensibilisierung und geben Schwarzen Sportler:innen ein Gemeinschaftsgefühl. Sie können jedoch nicht alle Widersprüchlichkeiten bezüglich ihres Andersseins aus dem Weg räumen.
An dieser Stelle, so sollte man meinen, könne die Sportpsychologie ansetzen. Dies betrachtet die Autorin der Studie jedoch kritisch. Wenn man sich einen Überblick über die Sportpsycholog:innen, die in Deutschland praktisch mit Sportler:innen arbeiten, verschafft, wird schnell klar, dass es sich fast ausschließlich um weiße Akademiker:innen handelt. Es gibt natürlich Ausnahmen, jedoch werden die meisten Schwarzen Athlet:innen ein:e weiße:n Sportpsycholog:in als Ansprechperson haben. Einerseits könnte das problematisch werden, weil die weißen Sportpsycholog:innen Unsicherheiten in Bezug auf das Thematisieren der Hautfarbe haben könnten und eine ausreichende Sensibilisierung fehlen dürfte. Dadurch würde eine konstruktive Zusammenarbeit scheitern. Andererseits bereitet es der Autorin Unbehagen, einer fast ausschließlich weißen Gruppe von Menschen Handlungsempfehlungen für eine Schwarze Gruppe von Menschen zu geben. Zugespitzt ließe sich dann die Frage stellen: wie können wir (die Sportpsycholog:innen) den Schwarzen Athlet:innen aus ihrem Dilemma helfen, an dessen Verursachung wie selbst (direkt oder indirekt) beteiligt sind? Davon abgesehen, dass es historisch fragwürdig ist, Empfehlungen zu geben, wie eine Gruppe Menschen, mit einer anderen umgehen sollte.
Daher die Empfehlung in der sportpsychologischen Arbeit mit Schwarzen Sportler:innen: erst bei sich selbst anfangen, sich eigene Stereotype bewusst machen und hinterfragen und die eigene Position verorten. Außerdem für die eigene Sensibilisierung sorgen. Von da aus lässt sich möglicherweise ein Weg für eine hilfreiche sportpsychologische Unterstützung ebnen. Zudem kann über die Arbeit mit Betroffenen hinaus, bei weißen Trainer:innen, Teammitgliedern etc. angesetzt werden.
Gegenwärtiges und Zukünftiges
Die Erfahrung, das Anderssein bewahren und zugleich Vereinheitlichung herstellen zu wollen, machen nicht nur Schwarze Sportler:innen. Allgemein sind marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft von diesem Dilemma betroffen. Das gilt für Menschen, denen man ihr Anderssein ansieht oder anmerkt als auch für Menschen, die es eher verbergen können. Dementsprechend lässt sich die Paradoxie des Gegenstandes mehrfach in der Gegenwartskultur wiederfinden. Die unterschiedlichen Erfahrungen von Menschen mit Be_hinderung, queeren Menschen, Muslim:innen und etlichen anderen marginalisierten Gruppen sollten nicht miteinander verglichen oder aufgewogen werden. Denn daraus ergäbe sich die Gefahr, Diskriminierungsformen zu hierarchisieren. Stattdessen wäre es interessant, das Erleben von Sportler:innen, die anderen oder zusätzlichen strukturellen Diskriminierungsformen ausgesetzt sind, zu untersuchen. Dieser Ansatz leitet den Ausblick für weitere Forschung ein.
Insbesondere sollten intersektionale Perspektiven von Sportler:innen erforscht und beschrieben werden. Darüber hinaus wurde aus dieser Untersuchung ersichtlich, dass es eine Art Mythos um Schwarze Legenden im Sport gibt. Legenden wie Michael Jordan sind über Jahrzehnte hinweg Vorbilder und scheinen für viele etwas Überlegenes sowie Übermenschliches an sich zu haben. Interessant wäre es, diesen Mythos zu erforschen und mit der Realität abzugleichen. Außerdem deuten die Ergebnisse dieser Studie darauf hin, dass sich das Erleben Schwarzer Sportler:innen je nach Sportart unterscheidet. Aus diesem Grund wäre zukünftige morphologische Forschung von Relevanz, die sich mit einzelnen Sportarten auseinandersetzt und tiefer in die spezifischen Sportarten blicken lässt. Da sich die Ergebnisse dieser Studie auf den Profibereich beschränken, wäre eine Untersuchung des Erlebens Schwarzer Kinder im Sport denkbar. Der Kinderbereich ist häufig noch weniger oder überhaupt nicht professionalisiert, allerdings sind bereits die Kinderjahre dafür mitentscheidend, wer es später in den Profisport schafft.
Aikins, M. A., Bremberger, T., Aikins, J. K., Gyamerah, D., & Yıldırım-Caliman, D. (2021). Afrozensus 2020: Perspektiven, Anti-Schwarze Rassismuserfahrungen und Engagement Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland. www.afrozensus.de
Arndt, S., & Ofuatey-Alazard, N. (Hrsg.). (2015). Wie Rassismus aus Wörtern spricht: (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache ; ein kritisches Nachschlagewerk (2. Auflage). Unrast-Verl.
Barskanmaz, C. (2020). Critical Race Theory in Deutschland. https://pure.mpg.de/rest/items/item_3263709/component/file_3265676/content
Bröskamp, B., & Alkemeyer, T. (Hrsg.). (1996). Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft: Vol. 72. Fremdheit und Rassismus im Sport: Tagung der DVS-Sektion Sportphilosophie vom 9. – 10.9.1994 in Berlin (1. Auflage). Academia Verlag.
Cöln, C. (7. Juli 2019). Box-Präsident kündigt nach Hymnen-Eklat seinen Rücktritt an. Streit um Deutschlandlied. https://www.welt.de/sport/boxen/article196502249/Streit-um-Deutschlandlied-Box-Praesident-kuendigt-nach-Hymnen-Eklat-seinen-Ruecktritt-an.html
Dernbach, M., Hartmann-Tews, I., & Nobis, T. Meritokratischer Mythos? Zum Erleben von Rassismus im Spitzensport. In Abstractband Abstractband zur Jahrestagung 2024 dvs-Sektion Sportsoziologie: Sportsoziologie als Krisenwissenschaft (p. 24).
Deutscher Fußball-Bund (Hrsg.). (21. März 2023). Sport überwindet Grenzen: Gemeinsames Zeichen gegen Rassismus. https://www.dfb.de/news/detail/sport-ueberwindet-grenzen-gemeinsames-zeichen-gegen-rassismus-249530/
DOSB (Hrsg.). (2023). Internationale Wochen gegen Rassismus 2023 – Misch Dich ein! https://integration.dosb.de/inhalte/aktionen/frankfurter-buchmesse-1#akkordeon-36790
Eggers, M. M., Kilomba, G., Piesche, P., & Arndt, S. (Hrsg.). (2005). Mythen, Masken und Subjekte: Kritische Weißseinsforschung in Deutschland (1. Auflage). Unrast-Verl.
Eggers, M. M., Kilomba, G., Piesche, P., & Arndt, S. (2005). Konzeptionelle Überlegungen. In M. M. Eggers, G. Kilomba, P. Piesche, & S. Arndt (Hrsg.), Mythen, Masken und Subjekte: Kritische Weißseinsforschung in Deutschland (1. Auflage, pp. 11–14). Unrast-Verl.
Fehr, M. (19. Juli 2024). Sprinter Owen Ansah vor Olympia: „Ich geh da hin und mach mein Ding“. https://www.swr.de/sport/mehr-sport/leichtathletik/owen-ansah-deutscher-rekordhalter-olympia-paris-rassismus-100.html
Guillaumin, C. (1995). Racism, sexism, power and ideology. Critical studies in racism and migration. Routledge. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0648/94012149-d.html
Hegerfeld, S. (2024). Was ist Rassismus? https://www.gleichstellungsportal.de/abc-der-gleichstellung/rassismus/
Hof, E. von (20. November 2020). Für Schwanensee war sie nicht weiß genug. Diskriminierungsvorwürfe gegen Berliner Staatsballett. Der Spiegel. https://www.spiegel.de/kultur/ballerina-wirft-berliner-staatsballett-diskriminierung-vor-fuer-schwanensee-war-sie-nicht-weiss-genug-a-00000000-0002-0001-0000-000174103668
Nobis, T., Lazaridou, F. B., Grun, S., Lejeune, S., Ludwig, A., & Philp, J. (2022). Racist Stacking im deutschen Spitzensport: Wieso es keine Schwarzen Torhüter in der Fußball-Bundesligagibt und was das mit Rassismus zu tun hat. NaDiRa working papers + / DeZIM-Institut: #02. DeZIM-Institut. https://www.rassismusmonitor.de/fileadmin/user_upload/NaDiRa/Pdfs/Working_Papers/NaDiRa_Working_Papers_2.pdf
Peucker, M. (2010). Racism, xenophobia and structural discrimination in sports: Country report Germany. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-67056-2
Rattansi, A. (2020). Racism: A very short introduction (2. Auflage). Oxford University Press.
Salber, W. (2018). Märchenanalyse. Bouvier.
Sow, N. (2015). Schwarz für Weiße. In S. Arndt & N. Ofuatey-Alazard (Hrsg.), Wie Rassismus aus Wörtern spricht: (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache ; ein kritisches Nachschlagewerk (2. Auflage, pp. 608–610). Unrast-Verl.
Sow, N. (2018). Deutschland Schwarz Weiß: Der alltägliche Rassismus (10 Jahre – aktualisierte Ausgabe). BoD-Books on Demand.

Autor:in
Pauline Frimpong Eismann studierte Sportpsychologie (M.Sc.) an der Business & Law School Berlin. Ihr Steckenpferd ist beruflich wie privat der Sport, in dem sie seit über zehn Jahren als Übungsleiterin, Trainerin und studentische Hilfskraft in unterschiedlichen Bereichen mit Kinder und Jugendlichen arbeitet. Sie ist zertifizierte systemische Coachin und widmete sich während ihrer gesamten Studienlaufzeit Diversitätsthemen in ihren Forschungsarbeiten.
Kontakt: pauli.eismann@htp-tel.de