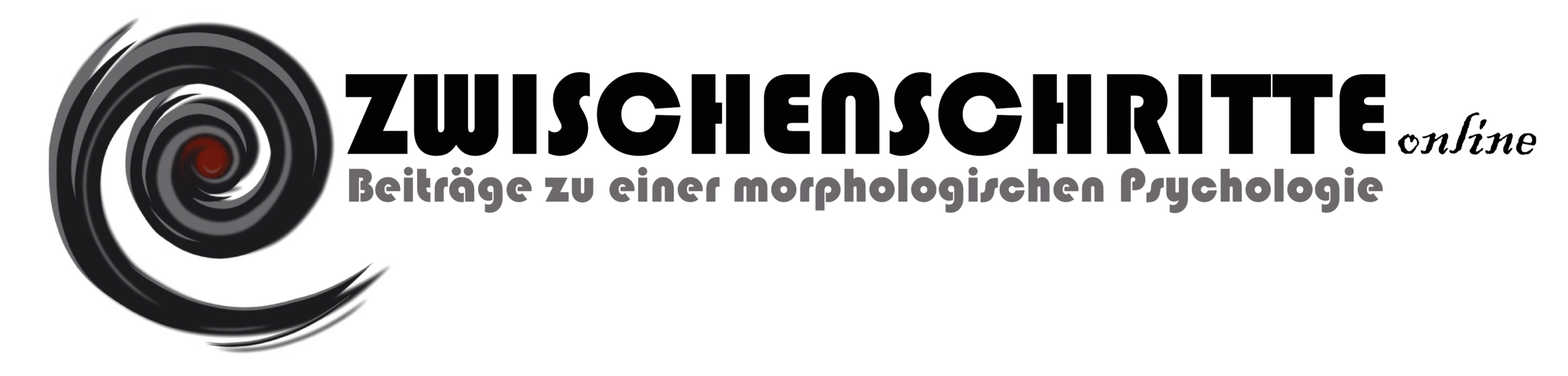Was ist Intensivberatung? [Reprint]
Autor:in
Dr. Yizhak Ahren
Arbeitsschwerpunkte: Kommunenforschung, Medien, Klinische Psychologie
Veröffentlichungen u. a. über „Holocaust“ und „Gegenkultur“
Was ist Intensivberatung?
Yizhak Ahren (1984)
Was ist Intensivberatung?
1
Um Menschen, die an psychischen Störungen leiden und ihre Probleme nicht mehr alleine lösen können, eine Hilfe zu bieten, hat die wissenschaftliche Psychologie eine Reihe von Therapieformen entwickelt. Dass Psychologen Neurosen und andere seelische Leiden behandeln, obgleich die rechtliche Absicherung dieser Behandlungen hierzulande noch umstritten ist, darf man als allgemein bekannt voraussetzen. Über die Eigenart der psychologischen Arbeit herrscht aber in weiten Kreisen ein unklares und mitunter sogar ein ausgesprochen falsches Bild. Auf ein weitverbreitetes Vorurteil hat Sigmund Freud schon vor vielen Jahren hingewiesen: „Wenn Sie eine physikalische oder chemische Frage aufwerfen, wird ein jeder schweigen, der sich nicht im Besitz von ‚Fachkenntnissen‘ weiß. Aber wenn Sie eine psychologische Behauptung wagen, müssen Sie auf Urteil und Widerspruch von jedermann gefasst sein. Wahrscheinlich gibt es auf diesem Gebiet keine ‚Fachkenntnisse‘. Jedermann hat sein Seelenleben, und darum hält sich jedermann für einen Psychologen. Aber das scheint mir kein genügender Rechtstitel zu sein. Man erzählt, dass eine Person, die sich zur ‚Kinderfrau‘ anbot, gefragt wurde, ob sie auch mit kleinen Kindern umzugehen verstehe. Gewiss, gab sie zur Antwort, ich war doch selbst einmal ein kleines Kind.“ (Gesammelte Werke Bd. 14, 219). Nicht selten ist es erforderlich, den Unterschied zwischen Psychologen und Psychiatern zu erklären. Dass Psychologen psychodiagnostische Tests durchführen, ist zweifellos richtig – aber wenn Testergebnisse und Statistiken in den Vordergrund gerückt werden, kommt ein irreführendes Bild von der Tätigkeit vieler Psychologen zustande. Die Frage, wie die Arbeit des Psychologen wirklich aussieht, ist in der Tat nicht einfach zu beantworten. Man muss sich erst klarmachen, dass es „die“ Psychologie gar nicht gibt. In der breiten Öffentlichkeit wird die Tatsache nicht genügend berücksichtigt, dass sich zwei grundlegend verschiedene Auffassungen der wissenschaftlichen Psychologie entwickelt haben und nebeneinander existieren. Die eine Richtung orientiert sich an Konzepten und Methoden anderer Wissenschaften (Physiologie, Biologie) und kann deshalb als Anlehnungspsychologie bezeichnet werden; der zweiten Richtung geht es um autonome Gesetze seelischer Zusammenhänge: Diese Auffassung kann man in polemischer Zuspitzung als psychologische Psychologie bezeichnen. Die eingesetzte Methode entspricht der jeweiligen Theorie. Die psychologische Psychologie denkt in ganzheitlichen Entwicklungskonzepten und betont die Bedeutung der genauen Beschreibung seelischer Phänomene (Mitbewegungsmethode). Die Anlehnungspsychologie will keine verstehende Psychologie sein; das Seelische wird stillgelegt, indem man von vornherein festgelegte Einheiten isoliert und dann miteinander in Beziehung setzt (Stilllegungsverfahren). Beide Auffassungsweisen haben Therapieformen entwickelt; es gibt also psychologische Behandlungen nach der Mitbewegungsmethode und Behandlungen nach der Stilllegungsmethode der Anlehnungspsychologie. Die analytische Intensivberatung, von der hier die Rede sein soll, steht in der Tradition der psychologischen Psychologie; die tiefenpsychologisch fundierte Intensivberatung ist ein Musterbeispiel für die Arbeit mit der Methode der Mitbewegung.
2
Bei der Intensivberatung handelt es sich um eine Behandlungsform, die – das muss ausdrücklich gesagt werden – nur von qualifizierten Psychologen und nicht von Medizinern oder Philosophen gehandhabt werden kann. Ein Arzt, der seelische Belastungen nach einem psychologischen Konzept in wissenschaftlich verantwortbarer Weise verändern möchte, wird zum Psychologen und kann sich ein gründliches Studium der Psychologie nicht ersparen. Ein Medizinstudium ist demgegenüber unnötig für die analytische Psychotherapie – Gehirnphysiologie spielt hier keine Rolle – und ist deshalb auch keine Voraussetzung für die Ausbildung zum Intensivberater. Als Argument für die These, nur ein Arzt sollte leidende Menschen behandeln dürfen, wird manchmal daran erinnert, dass Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, von seiner Ausbildung her Mediziner war. Die Tatsache, dass Freud an der medizinischen Fakultät promoviert hat, ist richtig und niemand hat sie je bestritten; aber Freuds große Leistung besteht darin, dass er später eine Psychologie entwickelt hat, und zwar eine psychologische Psychologie. In seiner Schrift „Die Frage der Laienanalyse“ hat er dann 1926 expressis verbis festgestellt, dass der Analytiker eine psychologische und keine medizinische Ausbildung brauche.
Einen ähnlichen Standpunkt vertritt übrigens auch der Verhaltenstherapeut Hans Jürgen Eysenck: „Wirksame verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden sind wesentlicher Bestandteil der Vorbildung des Psychologen; sie stellen beim medizinischen Psychiater nur einen kleinen Teil der Ausbildung dar. Kein Abschnitt seiner medizinischen Ausbildung ist wichtig für verhaltenstherapeutische Behandlungsweisen, und die Gegenstände, die für die Behandlung wichtig sind (z. B. Lerntheorie, Konditionierung, Persönlichkeitsforschung, Sozialpsychologie usw.) hat er entweder niemals oder nur höchst flüchtig während eines kurzen Kurses kennengelernt, der einen Teil seiner späteren beruflichen Ausbildung darstellt. Mit anderen Worten: Wir haben den seltsamen Zustand, dass medizinische Psychiater das Recht in Anspruch nehmen, die von Psychologen vorgenommene verhaltenstherapeutische Behandlung neurotischer Patienten zu überwachen, obwohl es der Psychologe und nicht der Psychiater ist, der allein die Ausbildung erhalten hat, die notwendig ist, um diese Methoden richtig zu verstehen und einsichtig auszuüben. Eine Änderung ist hier unbedingt erforderlich; jede spezielle Art von Therapie sollte von demjenigen ausgeübt werden, dessen Ausbildung ausdrücklich auf die Ausübung dieser Pflichten abgestellt ist, nicht von anderen, deren Ausbildung kaum eine Beziehung zur Sache hat.“ (Die Zukunft der Psychologie. München 1977, 68f.). Eine gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychologen ist im Interesse der Patienten erstrebenswert; sie ist durchaus möglich, wenn Kompetenzfragen geklärt sind. Es muss ebenfalls ausdrücklich gesagt werden, dass nicht jeder Diplompsychologe in der Lage ist, Intensivberatungen durchzuführen. Wer eine Prüfung im Fach „Klinische Psychologie“ bestanden hat, ist – darüber sind sich alle einig – noch lange kein Psychotherapeut. Die Lektüre der Bücher von Wilhelm Salber über die analytische Intensivberatung („Kunst – Psychologie – Behandlung“, Bonn 1977 und „Konstruktion psychologischer Behandlung“, Bonn 1980) reicht keineswegs aus, um nach dieser Methode behandeln zu können. Ein kompletter Ausbildungsgang ist nach der Diplomprüfung zu absolvieren, bevor ein Kandidat sich als Analytiker qualifiziert und die Intensivberatung praktizieren kann. Eine Ausbildung zum Intensivberater ist nur in Köln möglich, und in dieser Stadt ist auch der Sitz der Wissenschaftlichen Gesellschaft für analytische Intensivberatung e. V.
3
Um die Eigenart der Intensivberatung zu charakterisieren, sind Angaben zu ihrer Theorie und Praxis erforderlich. Es handelt sich bei der Intensivberatung um eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie, die in 20 Behandlungsstunden die seelischen Schwierigkeiten eines Patienten analysieren und verstehen will und damit eine Veränderung der Ausgangslage einzuleiten sucht. Es gibt natürlich psychische Störungen, die man in 20 Wochen bei einer Sitzung pro Woche nicht erfolgreich behandeln kann – aber es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Intensivberatung nur für „leichte Fälle“ geeignet sei; es wird noch die Rede davon sein, welche Fälle ein Intensivberater nimmt und welche nicht. Um den Anspruch der Intensivberatung klar und scharf zu formulieren: Sie glaubt, in 20 Stunden einen Umbruch in den Lebenstechniken der Patienten bewirken zu können, für den andere Therapieformen erheblich mehr Zeit benötigen. Ein Vergleich mit dem psychoanalytischen Behandlungsprozess, der meistens erst nach einigen Jahren abgeschlossen wird, mag sich aufdrängen: Die Intensivberatung führt keine neuen Eingriffstechniken ein, hier gelten dieselben Regeln wie in der klassischen Psychoanalyse (alles sagen, Enthaltsamkeit usw.), und der Patient liegt auf einer Couch – aber die Intensivberatung ist keinesfalls mit einem „kleinen Ausschnitt“ aus der „großen Analyse“ zu verwechseln. Zwanzig Stunden einer klassischen Forschungsanalyse wären keine abgerundete Therapie. Die Verkürzung oder besser gesagt: Intensivierung ist nur von einem eigenen Behandlungskonzept zu rechtfertigen, das nun skizziert werden soll. Die Intensivberatung geht davon aus, dass das Seelische selbst als Behandlung zu verstehen ist. Alles, was wir im Seelischen beobachten können, sind Formen der Behandlung oder Selbstbehandlung; jeder behandelt Menschen und Dinge in einer bestimmten Weise. Die Behandlung fängt also nicht erst im Arbeitszimmer des Psychologen an; jeder Therapie geht eine Behandlungsgeschichte voraus. Eine psychologische Behandlung wird sinnvollerweise dann aufgesucht, wenn die natürliche Selbstbehandlung verkehrt gelaufen ist: Der Patient hat sich in eine Lage verrannt, die er als unerträglich erlebt und aus der er sich nicht mehr alleine heraushelfen kann. In der Intensivberatung wird die verkehrt gelaufene Selbstbehandlung systematisch analysiert, um Auflösungen und Umbildungen zu ermöglichen. Es geht darum, eine überstrapazierte seelische Organisation in eine besser verfügbare Formenbildung zu überführen. Die psychologische Behandlung will herausfinden, wie die Behandlung der Wirklichkeit beim Fall aussieht. Wenn man genau festhält, was sich tatsächlich abspielt, ist der erste Schritt zu einer möglichen Umstrukturierung bereits getan; die Beschreibung ist die Grundlage für Entwicklungsprozesse. Ein Patient, der seine verkehrte Selbstbehandlung korrigieren möchte, geht ein Arbeitsbündnis mit seinem Analytiker ein, und es wird ein gemeinsames Werk eingerichtet, in dem der Bauplan oder die Konstruktion der störenden Formenbildung ausdrücklich herausgearbeitet werden soll. In der Intensivberatung wird ein Bild gesucht, das die Konstruktion des Falles überschaubar macht. Das jeweils gefundene Bild ist gewissermaßen eine Zusammenfassung der analytischen Arbeit: Die Intensivberatung versucht den Patienten deutlich zu machen, in welchen Bildern sie leben. Das in der Beratung herausgerückte Bild, das Konstruktionsprobleme und Entwicklungsmöglichkeiten veranschaulicht, sollte der Analysand am Ende der 20 Stunden „mitnehmen“ – es kann ihm bei der weiteren Selbstbehandlung helfen. Das transportable Bild hat sich für die psychologische Behandlung als ein verkürzender Faktor erwiesen.
4
Man kann die analytische Intensivberatung als eine strukturelle Behandlung bezeichnen: Sie lässt sich von den Notwendigkeiten und Möglichkeiten seelischer Formenbildung leiten und geht planmäßig auf seelische Wirkungsstrukturen ein. Eine bestimmte Auffassung von Behandlung wird hier verknüpft mit einer bestimmten Auffassung von der seelischen Formenbildung, nämlich mit der Auffassung der morphologischen Psychologie. Die morphologische Psychologie geht von der Grunderfahrung endloser Verwandlungen aus: Wir erleben immer ein Ineinander von Gestaltbildungen und Übergängen. Die Selbstbehandlung ist ein Versuch, mit den ständigen Übergängen, den Gestaltungen und Umstrukturierungen des Seelischen zu Rande zu kommen. Die Selbstbehandlung kann dabei auch zu „Neurosen“ führen; das sind Lebensformen, bei denen der Versuch gemacht wird, dem Ungeheuerlichen endloser Verwandlungen zu entkommen durch eine bestimmte Grenzziehung: etwas wird verkehrt gehalten. Solche Formen sind mit der Preisgabe von Verfügbarkeiten und mit Störungen verbunden, die dann eine psychologische Behandlung erforderlich machen. Durch eine Analyse der verkehrt gelaufenen Selbstbehandlung will die Intensivberatung erreichen, dass die Entwicklung wieder anläuft, die durch das Verkehrthalten behindert wird. In der Analyse wird alles, was sich zeigt, auf Wirkungszusammenhänge hin zerlegt. Im Mittelpunkt der psychologischen Arbeit steht nicht das Verlagern eines lästigen Symptoms, sondern das Verstehen und Neubewegen struktureller Probleme des Patienten (die zur Entstehung des Symptoms geführt haben). In der Intensivberatung erhält der Analysand keine Ratschläge (z. B.: „X wäre für Sie besser als Y“) und ihm wird keine Lebensphilosophie nahegebracht (z. B. die „echte Persönlichkeit“). Im gemeinsamen Werk der Behandlung soll deutlich werden, und zwar für beide an diesem Werk beteiligten Personen, was beim Fall der Fall ist. Zusammen wird festgestellt, wie das Bild der individuellen Störung aussieht; das Bild in Bewegung soll Besitz des Falles werden. Der Intensivberater hält sich an methodische Regeln und geht nach einem bestimmten Plan oder Entwicklungsgang vor. Im geschützten Rahmen der Intensivberatung bringt der Patient die Geschichte seiner eigenen Behandlung zur Sprache, und er kann mit der Hilfe des Analytikers in Erfahrung bringen, was bei ihm mitwirkt, aber bisher nicht gesehen wurde. Methodisch wird ein Erzählstopp eingeleitet, der die zurechtgemachten Geschichten infrage stellt – der Kern der Sache rückt dann gegenüber den beliebten Geschichten der Selbstbehandlung in den Blick. Vom Patienten wird verlangt, dass er im Laufe der Beratung methodischer wird: Er soll die Dinge einmal mit anderen Augen sehen und mit anderen Mitteln angehen können. Mit dem Brechen „automatischer“ Lebenstechniken und dem Erproben anderer Methoden soll die Preisgabe von Lebensmöglichkeiten revidiert werden, die mit dem Verkehrt-Halten verbunden ist.
Dass die Intensivberatung mit Bildern arbeitet, ist bereits erwähnt worden. Die psychologische Behandlung rückt die Konstruktion des Patienten in ein ihm vertrautes Hauptbild und in ein unbemerktes, aber ebenfalls wirksames Neben- oder Gegenbild. Die Einsicht in die Verhältnisse zwischen Bild und Nebenbild – und das bedeutet in die Struktur des Verkehrt-Haltens – kann zu einer Reorganisation im Sinne der Therapie führen, zur Wiederfreisetzung der Selbstbehandlung. In der Schlussphase der Behandlung gewinnen Einübungsprozesse, die mit unvertrauten Formen des Bewerkstelligens zusammenhängen, an Bedeutung. Hier zeigt sich, ob die Analyse zu einer Änderung oder Korrektur der Ausgangslage geführt hat. Um die weitere Entwicklung der Selbstbehandlung in Gang zu halten und einschätzen zu können, wird von Anfang an vereinbart, dass ein halbes Jahr nach dem Abschluss der Beratung eine Katamnese stattfinden soll – erst dann ist die Intensivbehandlung abgeschlossen.
5
Die Frage nach der Wirkung des Behandlungswerks beschäftigt den Analytiker natürlich nicht nur am Ende der Behandlung; sie begleitet seine psychologische Arbeit von Anfang an. Am Maßstab des Entwicklungsgangs (Methodisch-Werden, Ins-Bild-Rücken, Bewerkstelligen) prüft der Therapeut, ob und welche Fortschritte die Behandlung macht, und außer dieser Einschätzung findet eine Kontrolle durch Supervision statt. Vor allem muss immer eingeschätzt werden, ob die Schwierigkeiten des Patienten durch 20 Stunden Intensivberatung zu beheben sind. Der Psychologe führt zunächst eine psychodiagnostische Untersuchung durch (Anamnese, Intelligenz- und Gestaltungstests) und bezieht die Ergebnisse auf ein Einschätzungsschema. Einbeziehen lassen sich Fälle, deren Struktur nicht fließend ist und auch nicht allzu starr. Ausgeprägte Formen des Verkehrt-Haltens kann eine Intensivberatung durchaus mit Erfolg behandeln. Eine Intensivberatung ist besonders dann empfehlenswert, wenn die Erfahrung von Konflikten oder Krisen da ist und der Patient seine Lage ändern möchte (Leidensdruck). Es ist auch einzuschätzen, ob der Patient vertragsfähig ist; nur wenn er in der Lage ist, Absprachen einzuhalten, kommt eine geregelte Behandlung zustande.
6
Die Intensivberatung ist eine Behandlungsmethode, die aus umfangreichen Vorarbeiten auf verschiedenen Gebieten der Wirkungsforschung hervorgegangen ist und die sich in der klinischen Praxis bereits bewährt hat. Es ist wichtig, ihre Chancen und Leistungsgrenzen zu sehen: Die Intensivberatung geht über das bei psychologischen Beratungen übliche Gespräch hinaus, ohne in einen langen psychoanalytischen Behandlungsprozess überzugehen. Die Überschaubarkeit der Intensivberatung bietet nicht nur einen ökonomischen Vorteil, wobei die Bedeutung der ökonomischen Aspekte nicht zu unterschätzen ist. Die Festsetzung der Behandlungszeit auf 20 Stunden lässt die Verkehrung der Therapie in eine endlose Forschungsanalyse nicht zu, und die Entstehung symbiotischer Lebensformen wird verhindert. Wer den Bericht der Bundesregierung „Zur psychiatrischen und psychotherapeutisch-psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung“ vom 25. November 1975 (Drucksache 7/4200 des Deutschen Bundestages) gelesen hat, der weiß, dass der „psychologische Gesundheitsdienst“ noch unterentwickelt ist. An den notwendigen Reformen werden verschiedene Gruppen mitwirken müssen. Wenn es um die psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung geht, kann die analytische Intensivberatung einen nicht unerheblichen Beitrag leisten.
Hinweis:
Dieser Artikel ist eine Neuauflage und wurde per Hand ins Digitale übertragen sowie an die neue Rechtschreibung angepasst. Wir bitten um Nachsicht für eventuelle Fehler.
Autor:in
Dr. Yizhak Ahren
Arbeitsschwerpunkte: Kommunenforschung, Medien, Klinische Psychologie
Veröffentlichungen u. a. über „Holocaust“ und „Gegenkultur“