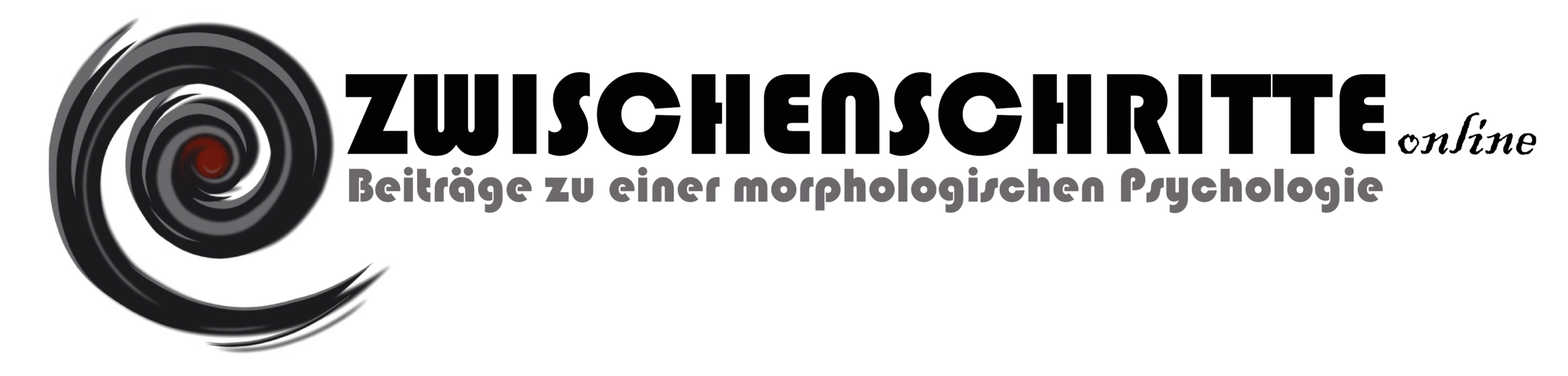„Wie der Mensch sich selbst begreift“ – Wilhelm Salbers Vorlesungen zur Entstehung der Psychologie
Herbert Fitzek rezensiert das neu erschienene Buch „Wie der Mensch sich selbst begreift“ von Daniel Salber zu den Vorlesungen seines Vaters (2025 im Psychosozial Verlag erschienen und ab sofort erhältlich).
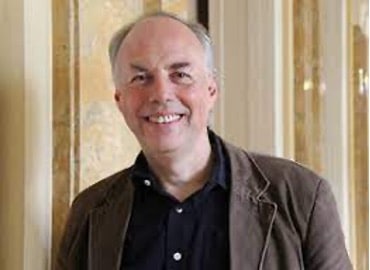
Autor:in
Prof. Dr. Herbert Fitzek Fitzek ist psychologischer Psychotherapeut und hat nach einer Therapieausbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie (Analytische Intensivberatung) einige Jahre lang freiberuflich als Psychotherapeut, Coach und Organisationsberater gearbeitet; 1999 Approbation als psychologischer Psychotherapeut. Seit 2006 als Gründungsdekan Aufbau des Bereiches Wirtschaftspsychologie im Fachhochschulbereich. Seit 2010 ist er als Prorektor Forschung in der Hochschulleitung der BSP Business & Law School Berlin tätig und engagiert sich in nationalen und internationalen Projekten und Kooperationen.
Kontakt: herbert.fitzek@businessschool-berlin.de
„Wie der Mensch sich selbst begreift“ - Wilhelm Salbers Vorlesungen zur Entstehung der Psychologie
Die Geschichte der Psychologie als Grundlage dafür zu nutzen, wie der Mensch sich selbst begreift, kann als zentrales Projekt des Psychologen Wilhelm Salber (1928-2016) angesehen werden. Darauf war bereits seine Habilitation in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ausgerichtet, in der er das (im „Archiv für Psychologie“) gesammelte Wissen der akademischen Psychologie aufarbeitete. Es ließ ihn nicht los, als er aus den wenigen für brauchbar befundenen (ganzheits- und gestalt-)psychologischen Fundstücken und einer Vielzahl weiterer philosophischer, anthropologischer und kulturpsychologischer Ansätze eine „Morphologie des seelischen Geschehens“ (1965) entwickelte, und es beherrschte auch seine Lehrtätigkeit als Leiter des Psychologischen Institutes II der Universität zu Köln zwischen 1963 und 1993, in der er mehr und mehr das Werk Sigmund Freuds für sich und seine Morphologie entdeckte. Kein anderes Thema stand so ausgiebig auf dem Lehrplan wie die Geschichte der Psychologie, zu keinem anderen Thema entstanden so umfangreiche Manuskripte (die Vorlesungen wurden mitgeschnitten und protokolliert), und doch entstand aus diesem Fundus am Ende seiner Lehrtätigkeit (1993) nur ein schmales, wenngleich überaus inhaltsreiches und lesenswertes Büchlein: die „Seelenrevolution“.
Seinem Sohn Daniel Salber ist es zu verdanken, dass mit der Herausgabe der Vorlesungsmanuskripte jetzt zu lesen ist, woraus die Seelenrevolution entstanden ist und wie aus gründlicher Lektüre der neuzeitlichen Philosophen, Schriftsteller und Kulturkritiker ein Apparat entstand, den Salber als Steinbruch für ein freieres, mutigeres, (nämlich) paradoxes Denken genutzt hat, mit dem er die Einzäunungen und (Selbst-)Fesselungen der klassischen Psychologiegeschichtsschreibung sprengen konnte. Was hier an Steinen zu knacken und Fesseln zu lösen war, ist gewaltig, und wie Salber im Einzelnen Detailgetreue und Deutungslust miteinander verband, ist nun also erstmals Wort für Wort nachzulesen. Eine genauere Nachprüfung würde allerdings voraussetzen, dass Lesewillige die besprochenen Texte im Original nachschlagen, denn mit Zitierungen hat sich Salber nie gerne, erst recht nicht beim Dokumentieren seiner Vorlesungen aufgehalten.
Klar wird, dass er, verglichen mit früheren Geschichtsarbeiten, am Ende seiner Lehrtätigkeit weit über die Psychologie als wissenschaftliche Disziplin hinausgegangen war. Für Disziplinierte würden Erasmus von Rotterdam, Luther und Machiavelli wohl eher in andere Fakultäten hineingehören, Shakespeare, Cervantes und Jonathan Swift in die Schriftstellerei, Marin Cureau de la Chambre, Edward Young und Adam Bernd ins Reich der Kuriositäten. Salber hingegen sah in ihnen gleichberechtigte Anwälte einer sich geschichtlich vollziehenden (Selbst-)Darstellung des Erlebens und Verhaltens und mehr oder weniger verwandte Vor- und Mitdenker seiner eigenen „psychologischen Morphologie“ – die großen Systematiker der Geistesgeschichte oft weniger passgerecht als die von ihnen und der Obrigkeit Marginalisierten, Verfemten und Ausgeschlossenen.
Salber hat sie alle gründlich gelesen und sich in der für ihn charakteristischen Weise auf jeden von ihnen einen (morphologischen) Reim gemacht. Eine Ordnung findet Salber in der bunten Reihe von Werkdurchsichten durch den Bezug zur Kulturgeschichte der Jahrhunderte: Im 16. Jahrhundert geht es um „Produktionsverhältnisse“ von Vernunft und Torheit (Erasmus), von Logik und Paradoxie (Franck), von Innerem und Äußerem (Luther), von Ausrichtungen der Kultur (Rabelais), um unvernünftige Gegensatzeinheiten (Montaigne). Daran schließt sich ein Jahrhundert der „Einheitssysteme“ (Giordano Bruno, Descartes, Bacon und Hobbes) und der dagegen laufenden Opposition an (Satiriker, Moralisten, Freidenker und Freifühler). Das 18. Jahrhundert ist beherrscht von „Perspektivenwelten“, die bei Leibniz wie Riesenuhrwerke gebaut sind, bei Jonathan Swift als Reiseerzählung, bei den Jesuiten wie Theaterkulissen. Damit das nicht zu gelehrt rüberkommt, bricht Salber die Ordnung immer wieder durch schräge Bezüge in die Vergangenheit hinein auf und auch in umgekehrter Richtung nach vorn bis in die aktuelle Lage hinein. Schließlich sollten die Studierenden spüren, dass Geschichte nicht abgesunkenes Kulturgut ist, sondern aus scheinbar Brandneuem herausbricht: keine Betriebskrise ohne Hamlet, kein Monsterfilm ohne Thomas Hobbes, kein Internet ohne G.W. Leibniz.
Denkmodelle sind in dieser Geschichte grundsätzlich mit Umordnung und auch mit Unordnung verbunden. Ein Textabschnitt stellvertretend für viele: „In den Darstellungen der Psychologiegeschichte findet sich meist ein Kapitel über die ‚Tierpsychologie‘ von [Hermann Samuel] Reimarus; die Fragmente eines Ungenannten zur Religionspsychologie, die Lessing 1774-1778 herausgab, bleiben jedoch unerwähnt. Dabei besteht zwischen diesen Untersuchungen ein enger Zusammenhang. Reimarus wendet sein Konzept von unterschiedlichen Bauformen oder Strukturen [tierischer Welten] auf die Religionsgeschichte an. Der ‚innere Bau‘ von Sekten hat ähnliche Merkmale wie die geschlossenen Welten der Tiere: Auslese, Bedeutsamkeiten (als Vorurteile), spezielle Kunstgriffe, Schwierigkeiten beim Umlernen. Die Jünger Jesu verstanden seine Lehre – seinen Bauplan – nicht; die Analyse ihrer Handlungen und Absichten zeigt keine Spur von Hoffnung auf Auferstehung“ (S. 140).
Was die großen Geister miteinander verhandelt haben, erscheint Salber nicht nur an dieser Stelle durch Psychologiehistoriker verkürzt … Dabei ist es psychologisch kein weiter Weg von der Lebenswelt der Sekten zu den Insekten … Man braucht dabei nur dem Bauplan der Formenbildung zu folgen: hier wie dort herrschen Struktur, Auswahl, Kunstgriffe, Umbildungen vor … Doch dafür haben die ‚Jünger Jesu‘ keinen Sinn … Und damit ist Salber wieder bei den schulmeisterlichen Vertretern der Psychologiegeschichte. Der Text bietet an nahezu jeder Stelle solche scharfsinnigen, gedrechselten, spitz(bübisch)en Vignetten, die aus profunder Textkenntnis heraus den Witz der Anspielung, Analogie, Absurdität und der hintersinnigen Zusammengehörigkeit von scheinbar Disparatem freilassen. Darüber geht über 264 Seiten (von geschätzten 1000 Seiten in der wörtlichen Vorlesungsmitschrift) keineswegs der Zug zum Ganzen verloren.
In der Mitte des 18. Jahrhunderts kommt nämlich noch einmal ein neues Muster der Seelengeschichte auf. In seinen Beiträgen zur Revision des gesamten Wissens der französischen Aufklärung („Encyclopédie“) bestimmt Denis Diderot die seelische Wirklichkeit als „bewegtes Bild…, nach dem wir unaufhörlich ein zweites malen… Wir leben nicht nur eine Geschichte, sondern wir suchen aus dieser Geschichte eine Geschichte zu machen“ (S. 136). Mit diesem Gedanken – und den Schlussfolgerungen, die Herder und Hegel daraus ziehen – erhält die Geschichte der Psychologie noch einmal eine andere Zentrierung: Geschichte der Psychologie ist spätestens jetzt nicht mehr nur das Aneinanderreihen von Bildern für Seelisches, sondern zugleich auch dessen Ausdrucksbildung und Selbstbehandlung über selbstverfertigte Bilder – und zwar durchaus nicht nur über (auf-)klärende und befreiende Bilder, sondern auch über beruhigende oder betörende und verstörende Bilder.
Im Zentrum von Salbers eigenwilliger Psychologiegeschichte stehen daher im Folgenden nicht die Stellvertreter für inhaltsloses Seelisches: Subjekt, Person, Individuum, und auch nicht die schmuckvollen Erfindungen der neueren Seelenarchitektur: Vernunft (Kant), Wille (Schopenhauer), Vorstellung (Herbart). Es ist die Idee einer „Gegenstandsbildung“, die man nach rückwärts und vorwärts in der Geschichte verfolgen kann. Denn wenn die Bilder der Geschichte ganz alltäglich gelebt werden und aus der alltäglichen Selbsterfahrung noch einmal Bilder geformt werden, die dann als Bilder der Psychologiegeschichte gelten, dann schreibt sich die seelische Wirklichkeit ihre Geschichte und ihre Bilder gleichsam zu ihrer eigenen Unterhaltung (im doppelten Sinne von Unterhalt und Vergnügen): Ihre Unaufgeräumtheit behandelt die seelische Wirklichkeit nach Art einer „Riesenkommode“ (daraus entstehen Psychologien wie die von Francis Bacon), ihre Planlosigkeit durch das Ausrollen einer „Kugelbahn“ (Condillac), ihre Kurzschlüssigkeit mittels artistischer Verdrehungen (Lichtenberg) usw. Nach vorne forscht Salber von nun an nach Denkern, die das doppelte Psychologieprogramm als Wissenschaft und Selbstbehandlung teilen und die Art, „wie der Mensch sich begreift“, als Kunststück von alltäglicher und wissenschaftlicher Selbsterfahrung präsentieren.
Für diese Idee der Gegenstandsbildung ist Salber nun eingestandenerweise „parteiisch“ (S. 189), wenngleich nicht im politischen Sinne, denn er entdeckt sie bei so unterschiedlichen Denkern wie Marx und Kierkegaard, Darwin und Nietzsche: Geschichte als Prozess, bei dem sich Seelisches auf die Schliche kommt und zugleich (lustvoll) betrügt. Darüber vergisst der Autor nicht, dass noch knapp 200 Jahre Psychologiegeschichte zu schreiben sind und neben den eigenen Vorbildern auch jene Strömungen der Psychologiegeschichte berücksichtigt werden sollen, die sich aufs Sichere und Elementare zurückziehen. Hauptgesichtspunkt für die Darstellung der Reihe von freundlichen und feindlichen Geistern bleiben auch jetzt die „Funktionsformeln“ der fortlaufenden Kulturgeschichte (S. 208): Psychologiegeschichte bewegt sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen ästhetischer Latenz und kommunistischem Manifest (Formel: „Mehr-Werden und Gleichmachen“), im ausgehenden 19. Jahrhundert zwischen bewahrendem Historismus und sich ausbreitendem Imperialismus („Erhalten und Verändern“). Freud und die Tiefenpsychologie offenbaren die Gleichwertigkeit von „Konstruktion und Mythologie“, das 20. Jahrhundert bewegt sich (auch psychologiegeschichtlich) zwischen „Blockzeiten“ und einer sich immer stärker ausbreitenden Inflation von Bildern. Salber beschließt seine Darstellung mit dem Konzept, das dieser Inflation Einhalt gebieten will, seinem eigenen, der psychologischen Morphologie.
Was die kulturgeschichtlichen Einordnungen mit dem Gedanken der Selbstbehandlung von Bildern in Bildern zu tun hat, deutet sich in den Vorlesungsmanuskripten nur an. Man braucht dafür die „Seelenrevolution“, auf die das alles ja verlegerisch hinauslief und die bereits kurze Zeit nach Ende der öffentlichen Vorlesungen in den Druck gehen sollte. Anhand der von Daniel Salber 30 Jahre später edierten Vorlesungstexte lässt sich nun deutlich verfolgen, wie schnell aus dem noch unfertigen Konvolut der Werkbearbeitungen eine Fassung wurde, die das Konzept der Selbstbehandlung des Seelischen als Geschichte zuende dachte. Als aus der Selbstbehandlung des Seelischen hervorgehende Gegenstandsbildung …
… hat eine Geschichte der Psychologie logischerweise nicht erst im 16. Jahrhundert zu beginnen, sondern mit dem Auftauchen des Menschen auf der Welt (die „Seelenrevolution“ beginnt mit der Steinzeit [!])
… ist Psychologiegeschichte ein Werk unter (anderen seelischen) Werken und demnach organisiert nach den gleichen Konstruktionsprinzipien (jetzt ist jede Epoche charakterisiert durch ein psychologisches Grundverhältnis und erhält wie die Fälle der individuellen Fallpraxis ein passendes Märchen)
… sind die historischen Gestalten, und seien sie noch so genial, nur Werkzeuge der Selbstbehandlung des Seelischen… und dann müssen Köpfe rollen (statt Porträts der Autoren wie in der Edition der Vorlesungen skizzierte Salber in der „Seelenrevolution“ die einzelnen Epochen in treffenden Karikaturen)
Die Endfassung – seine „Seelenrevolution“ – verfasste Wilhelm Salber mit ausdrücklichem Bezug auf die „Comic History“ des englischen Schriftstellers Gilbert Abbott á Becket (1847/48). So wollte er sie gelesen haben, und also hilft es nichts: Wer die Vorlesungen zur Geschichte des Seelischen in ihrer Konsequenz kennen lernen will, muss spätestens danach auch die „Seelenrevolution“ lesen.
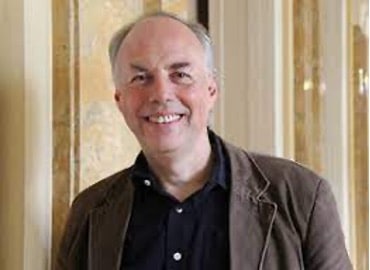
Autor:in
Prof. Dr. Herbert Fitzek Fitzek ist psychologischer Psychotherapeut und hat nach einer Therapieausbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie (Analytische Intensivberatung) einige Jahre lang freiberuflich als Psychotherapeut, Coach und Organisationsberater gearbeitet; 1999 Approbation als psychologischer Psychotherapeut. Seit 2006 als Gründungsdekan Aufbau des Bereiches Wirtschaftspsychologie im Fachhochschulbereich. Seit 2010 ist er als Prorektor Forschung in der Hochschulleitung der BSP Business & Law School Berlin tätig und engagiert sich in nationalen und internationalen Projekten und Kooperationen.
Kontakt: herbert.fitzek@businessschool-berlin.de