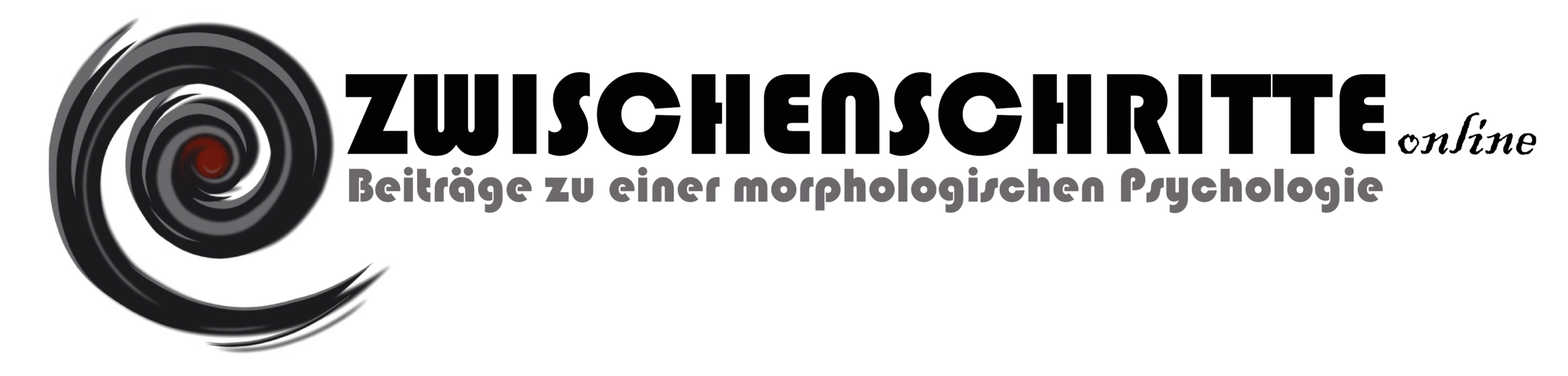Zur Entwicklung des klinischen Blicks in der Medizin und der Psychologie [Reprint]
Gedanken zur Situation: Gesundheitsreform und Psychotherapeutengesetz
Zur Entwicklung des klinischen Blicks in der Medizin und der Psychologie
Gedanken zur Situation: Gesundheitsreform und Psychotherapeutengesetz
Berk, H. Stelzner, W. (1992)
Zur Entwicklung des klinischen Blicks in der Medizin und der Psychologie
I. Zur Situation
In der aktuellen Gesundheitsdiskussion taucht der Gedanke, worum es eigentlich psychologisch in dem anstehenden Reformwerk des Bundesgesundheitsministers geht, in offizieller Form nicht auf. „Psychologie und Psychologisches“ finden sich gesundheitspolitisch nur punktuell gefasst; so bspw. formuliert im „Referentenentwurf zum Psychotherapeutengesetz“. Daneben existieren zu diesem Thema einige wenige, wenngleich bemerkenswerte Forschungsarbeiten (u. a. Mayer-Gutachten) sowie weiterführende Expertisen. Insbesondere noch zu erwähnen ist die im März 1992 verabschiedete „Psychotherapie-Bedarfsanalyse“ der Forschungsgruppe „Gesundheit und Soziales“. Denn gerade die letztgenannte Arbeit nimmt dabei ausdrücklich eine Bewertung und Gewichtung der im Zusammenhang mit dem anstehenden Therapeutengesetz unterschiedlichst gehandelten Zahlen vor. Deutlich ist in allen diesen Unterlagen der Versuch und das Bemühen zu erkennen, sich vermittels Zahlenmaterial und Zahlenanalysen einen klaren Überblick über die Notwendigkeit, den Bedarf und den Sinn eines solchen Gesetzeswerkes zu verschaffen. Die weite Spanne im Feld der unterschiedlichen Zahlenangaben zu diesem Komplex „Psychotherapeutengesetz“ macht jedoch stutzig. Bei genauerem Hinsehen wird denn auch schnell erkennbar, wie diese „Unterschiedlichkeit in der Einschätzung“ zustande kommt und welchem Zwecke sie unter Bezugnahme berufspolitischer Interessensgruppierungen dient. Fassen wir zusammen: In der öffentlichen, gesundheitspolitischen Argumentationsfindung zum Thema Gesundheitsreform sind Begriffe wie „seelische Gesundheit“, „psychologische Psychotherapie“, „Behandlung des Seelischen von der Seele aus“ oder „Beziehungsnahme von Körper und Seele“ so gut wie nicht zu finden. Auch die Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit (u. a. Medien) die verschiedenen politischen, pharmazeutischen sowie institutionell-medizinischen Positionen berechtigt werden, verstärkt den Eindruck, dass es in der kostenorientierten Diskussion um alles andere geht, nur nicht um den „Zusammenhang von Gesundheit und Psyche“. Dieses „fehlende Zusammenbringen“ bzw. diese „Unterlassung“ lässt denn auch den – wie wir glauben – zentralen Begriff des „Patientenwohls“ gleichsam zu einem „Fremdkörper“ in der Diskussion werden, den es offensichtlich zu isolieren gilt. Welchem Zweck dient das und warum, so fragen wir uns, werden Zahlen nur zur Kostendämpfung ins Feld geführt, jedoch nicht in Beziehung gesetzt zum Begriff der „begründbaren Investitionen“ im Rahmen einer mittelfristig wirksamen Strategie zur Etablierung eines eigenständigen Berufsstandes niedergelassener Diplom-Psychologen mit festgeschriebenem Leistungsrecht. So erscheint uns gerade der erstmalige Aufweis des oben angesprochenen Zusammenhangs von Gesundheit und Psyche und seiner Konsequenzen in einer prozessanalytischen Betrachtung als große Chance, eine fundamentale und zugleich weiterführende, gesundheitspolitisch umsetzbare Konzeption in der momentan so unversöhnlich geführten Gesundheitsdiskussion zu entwickeln.
II. Ein Überblick
Die Brisanz in der Argumentenwahl und die sich zeigende „Unversöhnbarkeit“ der gesprächsführenden Gruppierungen sind historisch bedingt. Ein Streifzug durch verschiedene medizinhistorische Abhandlungen (wie etwa bei Lichtenhäler und anderen) verdeutlicht den immer mehr körperorientiert werdenden Kern jener jahrhundertealten Idee, dass es irgendwann in der Medizin möglich sein müsste, Stoffwechselprozesse und Körpervorgänge in zunehmender Distanzierung vom Seelischen zu begreifen. Kritiker der ausschließlich körperorientiert denkenden Disziplinen in der Medizin sprechen heutzutage sogar von einer einsetzenden „Mechanisierung des Denkens“, in der ein Verständnis vom Seelischen zunehmend in den Hintergrund geraten musste und geraten ist. Vielleicht lassen sich – bei vorsichtiger Formulierung – verschiedene Daten für das Auseinanderfallen einer „Leib-Seele-Ganzheitsauffassung“ festmachen. Aber als Daten von besonderer Tragweite für ein in der Folge medizinisch aufgeklärtes, körperorientiertes Denken wären sicherlich nach Lichtenhäler, Aschoff u. a. das Erscheinen des ersten anatomischen Lehrbuches im Jahre 1543 („De humani corporis fabrica“) sowie 1628 die Entdeckung des großen Blutkreislaufs durch W. Harvey zu nennen. Auch Vesalius (s. u. a. bei Blechschmidt) wäre mit seinen Arbeiten als markanter Einschnitt festzuhalten. Von nun an ist eine „institutionell“ greifende Differenzierung und Spezialisierung des medizinischen Wissens zu beobachten, die als Ausdruck einer konsequenten Anwendung „naturwissenschaftlicher“ Methoden und Denkweisen verstanden werden kann. In dieser konsequenten Anwendung erfuhr und erfährt bspw. der einstmals philosophisch geprägte „Substanzbegriff“ einige bemerkenswerte Verwandlungen. Letztlich wird er heutzutage „stofflich“ verstanden, „fassbar“, mit „Eigen- und Fremdkörperhaftem“ in Beziehung gesetzt, „überschaubar“, „kontrollierbar“. Und vergessen wir nicht, einen kleinen Blick auf die pharmazeutische Industrie zu werfen. Hier wird eine Auffassung von „Substanz“ erkennbar, die diese in ihrer Eigenschaft als Bestandteil eines jeden Produktes zu einem „wertvollen Rohstoff“ macht. Diesen „Rohstoff“ gilt es so zu bearbeiten, dass er letztlich unter exakt beschriebenen Bedingungen – weil bis dahin oft empirisch erprobt – einem „körperlich greifbaren Stoffwechselgeschehen“ zugeführt werden kann. Dass es dazu einer genauen Kenntnis der ursprünglichen Wirkweisen des Rohstoffes sowie möglicher Wirk-Veränderungen im Herstellungs- bzw. Bearbeitungsprozess bedarf, sei nur am Rande erwähnt. Das Wissen um Rezepturen, Indikationen sowie um Behandlungsbedarf und anderes mehr ist somit zu einem Schlüssel für einen „Substanzbegriff“ geworden, dessen „Wertigkeit“ bei zunehmender Komplexität des Verständnisses körperlicher Vorgänge gesellschaftlich zuzunehmen scheint. Dies ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass über die zunehmend verstandene Komplexität zunächst „Einflussnahme“ und „Beherrschbarkeit“ auf sich einstmals dem medizinischen Verständnis entziehende Prozesse behauptet werden konnte. Über dieses gleichsam „dinglich-stoffliche“ Sich-Verfügbar-Machen-Können vermittels Substanzen konnte „Vieles“, was im Zusammenhang mit auftretenden Krankheiten Angst und Schrecken – weil nicht verstehbar – erzeugt hatte, gebändigt und gezähmt werden. Ob es letztlich seine furchteinflößende Kraft verloren hat, sei dahingestellt. Es hat den Anschein, dass sich hier eine Entwicklung beschrieben findet, die eine besondere Aufmerksamkeit verdient: nämlich die zunehmende Ausschließlichkeit der Betrachtung körperlicher Vorgänge bei Fragen von Gesundheit und Krankheit. Diese Auffassungsweise muss aus der Logik der Sache heraus zu einer endgültigen Ausschließung des seelischen Geschehens und seiner Verflechtungen mit dem Körperlichen führen. Damit ist natürlich auch der Entwicklung eines seelischen Bezugssystems – wie es in der Physik etwa die Relativitätstheorie leistet – die Grundlage entzogen. Damit kann man dann nicht mehr Seelisches vom Seelischen aus zu verstehen suchen. Aber: Eine Tablette hilft, Kopfschmerzen zu lindern – eine „psychologisch“ gestellte Frage kann das auch! Eine psychologisch gestellte Frage kann darüber hinaus auf das Zusammenspiel von „Abhängigkeiten“, „Sehnsüchten“, „Hoffnungen“, „Gefühlen“, „Ängsten“ und „Wünschen“ verweisen. Ein Zusammenspiel, das sich so auf keinem Rezeptblock (nicht wertend gemeint!) finden kann.
III. Kurzbetrachtung einer psychologischen Psychotherapie
Inzwischen hat es in der Geschichte einer „psychologischen Psychotherapie“ ein in unzähligen therapeutischen Sitzungen weiterentwickeltes Verstehen um die Wirkweisen und die Ausgestaltungen des „seelischen Geschehens“ sowie der „wechselseitigen Bedingtheit“ körperlicher und seelischer Prozesse gegeben. Diese Erfahrungen haben auch ihren berufspolitischen Niederschlag gefunden, der sich bisweilen in einer hervorragenden, klar umgrenzten Zusammenarbeit niedergelassener Ärzte und Psychologen findet, die sich zugleich um ein Anerkennen der strukturellen Andersartigkeit von seelischen und körperlichen Vorgängen bemühen. Ein „seelisches Verstehen“ fragt nach Verläufen und Zusammenhängen im Aufweis von „Davor–Dahinter“, von „Zulassen-Können“ und „Grenzziehung“. Demgemäß geht eine „psychologische Psychologie“ auch von autonomen Gesetzmäßigkeiten der Psyche aus. Und diese sind nicht aus einem medizinischen Verständnis der Körpervorgänge ableitbar. Wer sich näher mit den seelischen Prozessen auseinandergesetzt hat, weiß auch, dass sie nichts mit dem zu tun haben, was wir im Alltagsgebrauch als „logisch“ empfinden. Seelische Tatsachen formieren sich auf ganz eigenen Wegen. Und wie sich seelische Zusammenhänge bilden, unterliegt eigenen Regeln. Verstehbar ist dies alles nur durch eine profunde Kenntnis der Logik seelischer Vorgänge – und durch die Kenntnis der Entfaltung der Seele in der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen. Und dabei wird deutlich, dass es zum Gesetzmäßigen in seelischen Ausdifferenzierungsprozessen gehört, dass es Zeit braucht. Zur Verdeutlichung: Ein Klient im 41. Lebensjahr hat gut 2080 Wochen gelebt. Dies sind 14 560 Tage oder 349 440 Stunden. Man muss sich einmal klarmachen, wie viel Zeit das ist, die ihm bzw. ihr in der Entwicklung der seelischen Struktur zur Verfügung gestanden haben. Und diesen Gedanken sollten wir festhalten; macht er doch deutlich, wie wenig Zeit für eine psychologische Intervention bzw. Begleitung von offizieller Seite (Kassen) vorgesehen wird, wenn von 50, 80 oder 120 Stunden Bewilligung durch die Kassen die Rede ist. Dass Seelisches Zeit braucht, ist also so noch gar nicht genügend verstanden – und lässt sich auch mit Blick auf die Kostenstrukturen im Gesundheitswesen nicht wegdiskutieren. Psychotherapeutisch verursachte (vermeintliche) Mehrkosten sind letztlich notwendige „Investitionen“, die zu Minderkosten in anderen Bereichen führen. Das kann man dann verstehen, wenn man „Gesundheit und Psyche“ zusammendenkt. Was für die eine Seite der Medaille hinsichtlich der Zeitfrage gilt, gilt auch für die andere. Denn auch die Ausbildung zu einem fähigen und befähigten Psychotherapeuten braucht Zeit, um die seelische Struktur in ihrer vom Körperhaften so verschiedenen Eigenheit begreifen zu lernen.
Übertragen wir das eben zur „Zeitnot“ Gesagte einmal auf Entscheidungsprozesse: Wie gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich mit „Zeit“ heutzutage umgegangen wird, erfahren wir zunehmend an den Auswirkungen von aktuellen gesellschaftlich relevanten Entscheidungen. In der rasenden Eile der Informationsbewältigung bleibt – so hat es den Anschein – immer häufiger auf der Strecke, was man eigentlich im Wesen verstehen wollte. Für das seelische Geschehen – und diese Fokussierung sowie Verkürzung im Denken mag man uns an dieser Stelle gestatten – stellt ein solcher Umgang mit Zeit und Informationen eine gefährliche Entwicklung dar, wie die sich zuspitzenden gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse zeigen. So mag es denn auch nicht weiter verwundern, dass Kritiker der anstehenden Gesundheitsreform, die es unter Zeitdruck aufgrund der angeführten Kostensituation zu verabschieden gilt, gerade aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität mangelnde strukturelle Transparenz vorwerfen. Aber geht es wirklich darum? Ist das Wesen des Reformwerks wirklich so schwer auszumachen, weil mangelnde Transparenz vermutet werden muss – was heißen soll, dass kaum noch einer weiß, um was es wirklich geht? Ein volkswirtschaftlicher Blickwechsel in der Betrachtung des Reformwerkes könnte vielleicht schnell augenfällig werden lassen, dass es so gar nicht um „Transparenz“ geht. Vielmehr finden sich auf dem Boden eines marktwirtschaftlichen Denkens jene Gesetzmäßigkeiten angewendet, die den inzwischen tradierten wirtschaftlichen Vorsprung vor vermeintlichen Mit-Wettbewerbern sichern (Zugang zu den Kassen/Lobbyismus). „Macht“ und „Ausdehnung“ sind in einem solchen Denken zwei zentrale Größen, die charakterisieren helfen, was „Monopole“ ausmacht. Das berufspolitische „Erschließen neuer Räume und das Sichern Bestehender“ ist ein immanenter Gliedzug marktwirtschaftlichen Denkens. Daran ist nichts Verwerfliches zu finden – das ist eine marktwirtschaftliche Grundbedingung! Schließt man sich dieser volkswirtschaftlich bekannten Sichtweise an, dann wird verstehbarer, wieso es in der derzeitigen gesellschaftspolitischen Diskussion nicht um die Idee gehen kann, dass „Fehlentwicklungen“ in irgendeiner Weise mit den Entwicklungsverläufen des Seelischen in Zusammenhang zu bringen sind. „Man guckt da ja gar nicht hin.“ Seelische Strukturen, wie sie uns allen eigen sind – egal, wo wir uns bspw. beruflich in der Verantwortung bewegen –, mit „Verfehlungen“, „Widerständigkeiten“ oder gar „Abhängigkeiten“ in Verbindung zu bringen, widerspricht offensichtlich einer bestimmten Logik vom grenzenlos „Machbaren“ und vom „Kontrolliert-Halten“ in jeder Form organisierten, zielgerichteten Denkens. Zu genau dieser Logik gehört „psycho-logisch“ jedoch ein immanentes, fast schon paradox anmutendes Verständnis von „Grenzziehungen“: Es ist eben nicht alles machbar! Das ist in diesem Zusammenhang ein schwergewichtiger Satz. Untersucht man nämlich psychologisch die „Logik des Machbaren und Kontrolliert-Haltens in monopolistischen Gefügen“ auf ihre offensichtlichen und verdeckten Verläufe, so finden sich „Grenzbereiche“, die – nunmehr in den Blick gerückt – nachvollziehbar von verschiedenen Interessensgruppierungen unterlaufen werden. So besteht bspw. eine dieser Überschreitungen ganz offensichtlich darin, nicht vor dem „Patientenwohl“ Halt zu machen (u. a. Flugblatt-Aktion). Hier wird verdeckt ein besonderer Umgang mit „Abhängigkeiten“ spürbar, wie er sich – laut eigener Kritik aus den Reihen der Mediziner – im quartalsweisen Umgang mit der „Verschreibung auf Krankenschein“ findet. Eine Aussage, die einige Mediziner (Region Berlin) selbst im Kampf gegen das vereinnahmende KV-Gefüge in die Waagschale geworfen haben. Übertragen auf die Gesundheitsreform sollte schnell deutlich werden, dass der Umgang mit Abhängigkeiten nicht so weit gehen darf, dass die freie Arztwahl bzw. freie Wahl des diplomierten psychologischen Psychotherapeuten gefährdet ist. So gesehen, finden sich im Zusammenbringen von verdeckten und offenen Verläufen in der Gesundheitsdiskussion tatsächlich einige Hinweise für die ökonomische Berechtigung, psycho-logisches Denken auszuschließen oder ihm gar eine berufs- und leistungsrechtliche Verankerung abzuerkennen. Der seltsam nüchterne und von klarer Entschiedenheit zeugende Entwurf, „Alles“ (das gesamte Reformwerk samt allen Interessensgruppierungen) zahlenmäßig im Griff haben zu wollen, weist denn auch – auf dem Hintergrund von „seelischen Abhängigkeiten“ – zunächst auf „Bewegungen“ hin, die es bei einer eingehenderen Betrachtung aber offenbar politisch zu meiden gilt. Gerade auch mit diesen „Bewegungen“ (wie bspw. der Idee, nichts mit Abhängigkeiten zu tun haben zu wollen oder zu können) setzen sich Psychologen und psychologische Psychotherapeuten auseinander. Es wäre hier an dieser Stelle sicherlich nicht falsch zu behaupten, dass der Bundesgesundheitsminister es als einer der ersten merkt, was das heißt. Denn in seinem Bemühen um Überblick und Klarheit, Glaubwürdigkeit und Durchsetzbarkeit, Berechenbarkeit und Verbindlichkeit muss er doch mit einer Vielzahl von Abhängigkeiten umgehen, muss er einem „Ausgeliefert-Sein“ nach allen Seiten zu entgehen suchen, um handlungsfähig zu bleiben. Dies hat mit dem „Fluch von Entscheidungen“ im Kreise von Interessensgruppierungen zu tun. In einem medizinischen Bild ließe sich sicherlich sagen, dass man einem schmerzhaften „Ausgeliefert-Sein“ durch die Verabreichung von Medikamenten (Substanzen) zu entkommen sucht. Genau die hier beispielhaft aufgeführten „Bewegungen“ sind es aber doch, die diplomierte Psychologen und ausgebildete, psychologische Psychotherapeuten in ihrem Umgang mit dem seelischen Geschehen aufgreifen. Sie machen deutlich, dass man vor seinem seelischen Leben mit all seinen „Verwirrungen“, „Verstrickungen“ (auch körperlichen), „Geradlinigkeiten“ und „Entschiedenheiten“ nicht davonlaufen kann. Sie zeigen „Grenzen“ auf und machen – so merkwürdig es klingen mag – „Vieles“, auch in der Symptombildung, überflüssig, indem sie (im Idealfall) ein zunehmend integrierendes „Zulassen-Können vermittels Einsichtnahme“ beim Einzelnen herzustellen suchen. Damit werden in diesen Bewegungen aber genau jene „Grenzziehungen“ durch ein erarbeitetes „Sich-Eingestehen“ möglich, von dem man sich loszusagen suchte. Es gehört zum seelischen Geschehen dazu, dass man eben nicht alles berechnen und im Blick halten kann. Das „Eingestehen-Können“ von Abhängigkeiten – und dazu gehören Grenzziehungen in einem komplexen Werk von Ideen, Kreativität, Interessensforderungen, politischem sowie wirtschaftlichem Druck – ist vielleicht der tragende Dreh- und Angelpunkt für die anstehende Reformierung des Gesundheitswesens, wenn es keine Worthülse sein soll. Ein wirkliches, soll heißen fachlich-wissenschaftlich begründetes „Eingestehen“ macht schnell deutlich, was in ein solches Reformwerk gehört und was nicht. Jeder der verantwortlich Mitwirkenden hat ein Seelenleben – und das ist weitaus mehr als die erworbene Menschenkenntnis. So gesehen, findet sich erst jetzt eine „Komplettierung“, die aufzeigt, dass ein psychologisches, an Prozessen und ihren Wirkungen orientiertes Denken dazugehört, will man die „Schwierigkeiten“ und „Verknotungen“, „polemischen Einseitigkeiten“ und „Ungereimtheiten“ in der derzeitigen Diskussion verstehen können und tragfähige Weichenstellungen für die zukünftige Gesundheitspolitik vornehmen. Alles andere wäre nur eine Verlagerung der Probleme in die Zukunft – politisch ist das die jeweils nächste Legislaturperiode.
IV. Zusammenfassung
Wir meinen, dass die Gesundheitsreform deshalb so extrem erschwert ist, weil sie sich – wie oben ausgeführt – auf ein monopolistisches Gebilde richtet, demgegenüber es kein „von außen“ entwickeltes „Argument“ gibt, welches Aufschluss über die strukturelle Wendigkeit des Ganzen gibt. Die Schwierigkeit in der Diskussion mit verantwortlichen Vertretern der organisierten Ärzteschaft in den vergangenen Monaten und auch gegenwärtig liegt unserer Einschätzung nach entschieden mit darin begründet, dass hier unterschiedslos Argumente aus ganz verschiedenen Bereichen „der Medizin“ verwendet werden – und zwar so, als ob es sich stets um „die Medizin“ im engeren, heilkundlichen Sinne handele. „Medizin“ existiert aber in ganz verschiedenen Zuständen:
– Medizin im engeren Sinne / Medizin zur Heilung
– Medizin als gesetzliche Forderung, Versorgung sicherzustellen
– Medizin in einer polizeilichen Funktion (Seuchen/Zwangseinweisungen)
– Medizin als Ideologie
– Medizin als verzweigtes wirtschaftliches Unternehmen
Wie gesagt, in der gesellschafts- und gesundheitspolitischen Diskussion mit „Medizinfunktionären“ werden diese Ausprägungen (Zustände) unterschiedslos angeführt, so als ob es sich eben immer nur um „Medizin im engeren Sinne, um Medizin zur Heilung“ handele. Man kann weiter mutmaßen, dass hinter dieser Argumentation dann rücksichtslos die beruflichen Interessen im Sinne des Monopols vorangetrieben werden. Eine sachliche Erwägung des „Patientenwohls“ im oben beschriebenen Sinne hat auf dieser Linie keinen Raum – sehr zur Verärgerung miteinander kooperierender niedergelassener Ärzte und psychologischer Psychotherapeuten, die sich als Berufskollegen außerhalb des – auch höchstrichterlich umstrittenen – „Delegationsverfahrens“ begegnen. Halten wir fest: Offensichtlich fehlt ein „Außenargument“, welches in der „Formulierung und Sicherung des Psychotherapeutengesetzes“ gegeben sein kann. Unter anderem hat sich auf diesem Feld zeigen lassen, dass der geschichtlich gewachsene Ansatz der Medizin – gemessen an den Notwendigkeiten einer „psychologischen Psychotherapie“ – in seiner Ausschließlichkeit betrieben Patienten schädigt. Es reicht auch nicht, dass Mediziner in immer weiter ansteigendem Umfang Psychotherapie betreiben, um sich – wie in einer Veröffentlichung aus Wiesbaden nachzulesen – weitere Arbeitsfelder zu sichern und „das Heft“ nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Sie werden nämlich dabei von der historisch gewachsenen Medizinorganisation vereinnahmt und nun der geltenden Medizinstuktur und -argumentation gewaltsam eingepasst, sodass sich Psychotherapie wie ein weiteres Medikament in der Medizin ausnehmen muss. Damit wird „Seelenbehandlung“ jedoch als „Außenargument“ untauglich. Erinnern wir uns weiter: Die Struktur der klassischen Medizin ist alles andere, nur nicht mit der Struktur einer psychologischen Psychotherapie in Einklang zu bringen. Alle Behauptungen seitens der „Medizinfunktionäre“, es werde nun „ganzheitliche“ Behandlung geben, dienen ausschließlich der Bekämpfung des „Außenargumentes“ in Form des Psychotherapeutengesetzes. Die Geschichte von „wirklichen“ Reformen ist die Geschichte von angewandten „Außenargumenten“. Nur dann hat sich die notwendige „Schubkraft und Bündelung“ für ein Voranschreiten finden lassen. Deshalb kann sich auch eine Gesundheitsreform nicht ausschließlich innerhalb des gewachsenen Medizinapparates in seinen dargestellten Ausprägungen bewegen, da es dann – um ein Bild zu wählen – zum „Hase-und-Igel-Effekt“ kommt: Der Medizinfunktionär ist bereits immer schon da. Wenn jedoch mit dem hier besprochenen Ansatz ernst gemacht wird, „psychologische Psychotherapie“ als eigenrechtliches Berufsfeld zu etablieren, kann von hier aus ein Gegengewicht – ein Außenargument – geschaffen werden. Wir haben hier einige Ausführungen gewählt, die deutlich machen können, was wir in der Gesundheitsdiskussion benötigen: ein Modell, das in der Lage ist, mit den „Kränkungen“, „Abhängigkeiten“, „Ausschließlichkeiten“ und „Vorwürfen“, aber auch aller folgerichtiger „immanenter Sachlogik“ umzugehen. Nur in einem solchen Modell bietet sich ein Konzept, das letztlich dem „Patientenwohl“ und dem dazugehörenden Recht auf freie Psychotherapeutenwahl und kollegialer Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten Rechnung trägt. Wenn man dies wirklich verstanden hat, dann gibt es in der berufs- und leistungsrechtlichen Verankerung eines „Psychotherapeutengesetzes“ keine Verlierer. Wenn das Psychotherapeutengesetz kommt, werden die Wogen nicht sonderlich hoch schlagen. Wenn das Psychotherapeutengesetz nicht kommt, wird die „Innenweltverschmutzung“ dramatisch wachsen. Die Auswirkungen sind doch bereits in grenzüberschreitenden Prozessen der Gesellschaft spürbar. An die Stelle der sinnlichen Gewissheit tritt brutale machtpolitische Interessensvertretung, die so auch vor dem Individuum nicht Halt machen wird. Die Rückkehr der kollektiven Angst ist eingeleitet. Wenn man diese Gedanken im Zusammenhang mit der Diskussion um die Gesundheitsreform aufgreift, wird die immense Chance im Inhalt des Psychotherapeutengesetzes deutlich. Denn: Nicht nur der mündige Patient würde festgeschrieben durch die Möglichkeit zur freien Psychotherapeutenwahl, nicht nur die Ausübung der berufsständischen Kontrolle der niedergelassenen psychologischen Psychotherapeuten durch Medizin-Funktionärstum würde verhindert, sondern ein – im Rahmen der Kostendiskussion – wichtiger, kostendämpfender Faktor etabliert. Und nicht nur dies: Das Psychotherapeutengesetz trägt in sich die Chance zu einem neuen Umgang mit unserem Gesundheitsverständnis. Statt marktwirtschaftlicher Verwaltung von Krankheit die Rückbesinnung auf die Selbstbestimmung.
– Dr. H.-J. Berk / Dr. W.-D. Stelzner
Anmerkungen
Beispielhaft soll dies anhand der Betrachtung des vom Hersteller behaupteten Indikationsanspruches von Arzneimitteln wie „Dipiperon“, „Dogmatil“ und „Theralene“ verdeutlicht werden. Der Indikationsanspruch bei „Dipiperon“ erstreckt sich auf: akut-produktive Psychosen, chronische Schizophrenien, Unterstützung bestimmter Neuroleptika, Stimmungslabilität, Affektverarmung, milieureaktive Verhaltensstörungen bei Kindern, involutiv bedingte Charakter- und Verhaltensstörungen (Stimmungslabilität), Aggressivität, Dysphorie. Der Indikationsanspruch bei „Dogmatil“ lautet: frühkindlicher Autismus, Stimmungslabilität mit Leistungs- und Initiativverlust, stressbedingte Erschöpfungszustände, kindliche Verhaltensstörungen, psychogene Anorexie, Unterstützung psychotherapeutischer Verfahren. Und „Theralene“ schließlich ist angezeigt bei: psychomotorischen Erregungszuständen von Zerebralsklerotikern sowie Unruhe und Verhaltensstörungen im Säuglings- und Kindesalter.
Hinweis:
Dieser Artikel ist eine Neuauflage und wurde per Hand ins Digitale übertragen sowie an die neue Rechtschreibung angepasst. Wir bitten um Nachsicht für eventuelle Fehler.