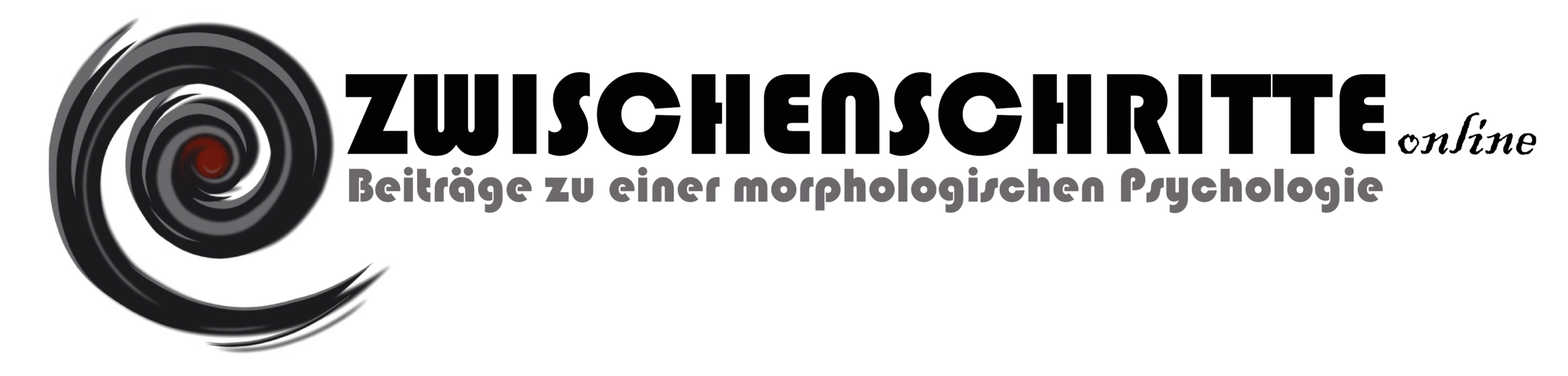Zum Umgang mit der Übertragung in langer und kurzer Analyse [Reprint]
Prof. Dr. Dirk Blothner (1992)
Autor:in
Dr. Dirk Blothner
Psychologisches Institut II der Universität Köln
Arbeitsschwerpunkte: Psychoanalyse, Intensivberatung, Filmwirkung
Veröffentlichungen zu „Psychoanalyse und Intensivberatung“, „Psychologische Diagnostik in der Klinik“, „Der amerikanische Freund“, „Carmen“
Zum Umgang mit der Übertragung in langer und kurzer Analyse
Im Laufe der Gespräche mit seinen Patienten macht jeder Psychotherapeut die Erfahrung, dass letztere beginnen, auf ihn in einer Weise zu reagieren, die nicht durch seine Person oder sein Verhalten ausgelöst zu sein scheint. Es handelt sich um Erscheinungen wie: heftige und fordernde Verliebtheiten, illusionäre Idealisierungen seiner Person und seiner beruflichen Kompetenz, feindselige Verdächtigungen, aber auch eine Bereitschaft, jedes Wort sofort zu glauben, das über seine Lippen kommt. Der praktizierende Psychologe kann solche Verhaltensweisen seiner Patienten übersehen, er kann sie ihnen auszureden suchen, sie mit dem Hinweis auf Regeln bekämpfen oder einfach für seine persönlichen Zwecke ausnutzen. Er nimmt sich dann allerdings die Möglichkeit, diese eigenartigen Erscheinungen in der Weise aufzugreifen, dass sie sein Verständnis des Falles vertiefen und dessen Genesung schließlich ermöglichen. In der von Freud begründeten psychoanalytischen Behandlung werden solche scheinbaren Inadäquatheiten nicht als störende Randerscheinungen angesehen, derer man sich möglichst schnell zu entledigen hat oder die man am besten nicht weiter beachtet. Seit Freuds Veröffentlichung des Falles „Dora“ (1905) gilt die Handhabung dieser sogenannten Übertragungen als der entscheidende Zugang zum Verständnis der Neurosen und als ein zentraler therapeutischer „Drehpunkt“ (Freud 1960, Brief vom 5.6.1917) einer Behandlung, die, durch den Austausch von lediglich Worten, hartnäckige und nicht selten körperlich manifestierte Störungen zu beeinflussen sucht. Eine 36-jährige Akademikerin setzt alles daran, ihrem Psychoanalytiker die sexuellen Phantasien und Tagträume mitzuteilen, von denen sie meint, dass er sie hören will. Zugleich versichert sie ihm, dass sie auf ehrliche Weise in ihn verliebt sei, dass sie es genieße, in seiner Nähe sein zu dürfen. Sie übt einen verantwortungsvollen Beruf aus, gilt als verlässliche Kollegin und wird wegen ihrer fachlichen Fähigkeiten allgemein anerkannt. Jedoch in den drei Wochenstunden, die sie in der Behandlung verbringt, benimmt sie sich wie ein verträumtes, halbwüchsiges Mädchen. Wenn der geschmeichelte Analytiker, trotz der ihm bekundeten Zuneigung, seine Arbeit fortzusetzen sucht, kippt die bewundernde Liebe der Patientin mit einem Male um. Sie verschließt sich jeder weiteren Beeinflussung und beteuert die heftigsten Hassgefühle gegenüber demselben Mann, den sie vorher sehnsüchtig umschwärmte. Diese Wandlung erschwert die gemeinsame Arbeit erheblich, da die Patientin nun nicht mehr in ihrer Störung den Hauptfeind erblickt, sondern in dem – mittlerweile ratlosen – Analytiker. Wie lassen sich solche schwer handhabbaren Erscheinungen erklären? Freud (1905, 1912, 1915, 1916–17) äußert die Auffassung, dass solche in der Analyse auftretenden Einstellungen gegenüber dem Analytiker nur ein Sonderfall einer allgemeineren Erscheinung sind. Er meint die Tendenz des Seelischen, einmal etablierte Muster des Verhaltens und Erlebens zu konservieren und zu wiederholen. Man kann den Begriff der Übertragung daher nicht ohne den Begriff der (Charakter-)Struktur verstehen. In seiner weiteren Bedeutung greift er die Beobachtung auf, dass ein Mensch in unterschiedlichen aktuellen Situationen in charakteristischer Weise handelt und erlebt. Die Werke, die sich im Austausch mit anderen Menschen ausgebildet haben, besitzen eine gewisse Konsistenz und suchen sich gegen die Korrektur des Rezenten durchzusetzen. Demnach übertragen wir die Umgangsformen mit Wirklichkeit, die wir früher eingeübt haben, auf die aktuellen Situationen und vollbringen damit zugleich eine Meisterung des Zufalls. Das muss sich nicht notwendig als störend bemerkbar machen, kann eher als eine sinnvolle Konstruktion angesehen werden, da damit der Vielfalt des Lebens ein gestandenes Repertoire an Bewältigungsformen an die Seite gestellt wird. Schwierigkeiten treten erst dann auf, wenn die wiederholten Muster zur einzig verfügbaren Methode werden und sich – auf Kosten der Beweglichkeit des Ganzen – zwanghaft durchsetzen. Soviel zu der weiteren Bedeutung von Übertragung. Die therapeutische Analyse bringt die Übertragung im engeren Sinne heraus, indem sie eine Verfassung herstellt, die von den gewohnten Alltagssituationen entscheidend abweicht. Im zwischenmenschlichen Alltag reagieren wir auf die Sonderbarkeiten unserer Mitmenschen mit Takt, Nachsicht, Ärger und Abwertung. Wenn wir sie schon ein wenig kennen, gehen wir einigen einfach aus dem Weg oder rechnen ihre Eigenarten von vornherein mit ein. Auf diese Weise können die charakteristischen Werke der Menschen sich selten zu einer gewissen Konturiertheit und Intensität steigern. In spannungsvollen Abkömmlingen – in dem, was wir „Stress“ nennen, in Beziehungskrisen, Krächen etc. – sind ihre Ableger dennoch zu konstatieren. Entzieht man nun dem Seelischen seine Alltagsstützen, indem man es in einen Werkzusammenhang versetzt, in dem es zur Regel wird, nicht zu reagieren, nicht zu fliehen, nicht zu bewerten, sondern zu beschreiben und alles zum Ausdruck zu bringen, was im Ansatz verspürt werden kann, dann müssen sich die eingeschliffenen Methoden der Wirklichkeitsbehandlung mehr und mehr abheben. Denn das Seelische kann nicht mehr auf die entschärfenden und vermittelnden Umgangsformen zurückgreifen, die im Alltag verfügbar sind. Der Zufall, die Verwandlungsseite der Wirklichkeit, wird mit dem methodischen Behandlungswerk paradoxerweise hervorgekehrt. Das Lebenswerk, das in diesen Zusammenhang gerät, kann nicht anders, als in der Weise zu handeln, die sich einmal herstellte, als es unter einem ähnlich starken Verwandlungsdruck gestanden hat. Diese Belebung der charakteristischen Methoden der Lebensgestaltung in der Analyse ist die Übertragung i. e. S. Man kann sie als eine „Zuspitzung“ (Salber 1980, 109 ff.) gelebter Wirklichkeit verstehen, die dadurch zustande kommt, dass ein beharrender, sich reproduzierender Kreis von Wirklichkeitsbehandlung in ein Werk gespannt wird, dessen Regeln in starkem Maße auf Ausdrucksbildung ausgerichtet sind. In gewisser Weise mutet die analytische Behandlung dem entwickelten Seelischen daher einen „Kulturschock“ zu. Es erscheint nicht hergeholt, wenn man die Lage des Falles mit der Robinsons vergleicht, der sich an den Strand einer unbewohnten Insel gespült sieht, auf der die Selbstverständlichkeiten und Alltagsstützen, an die er gewöhnt ist, nicht verfügbar sind. Was macht er? Er besinnt sich auf das Vertraute und kultiviert die wilde Insel mit den Methoden, die sich in seinem früheren Leben bewährt haben. Allmählich holt er alle Instrumentierungen, Muster und Umgangsformen aus dem Bauch des versunkenen Schiffes hervor, die er aus der „alten Welt“ mitgebracht hat. Nun wird verständlich, warum Freud die Übertragung als einen „Drehpunkt“ der Behandlung bezeichnen kann. Der Drehpunkt eines Werkes ist der Punkt, in dem es einerseits ruht und um den es sich andererseits dreht: Wenn wir die – in der Behandlung geäußerte – sehnsüchtige Liebe der 36-jährigen Patientin herausheben, haben wir zweierlei gewonnen. Erstens erhalten wir damit die Methoden vor Augen geführt, welche die ausgedehnte Konstruktion, die sich im Laufe ihres 36-jährigen Lebens ausgebildet hat, tragen und zusammenhalten. Ihre sehnsüchtige Liebe ist ihre Antwort auf die formale Kühle der Mutter und die verletzende Unbeholfenheit des Vaters dem Werben der Tochter gegenüber. Mit ihrer Liebe und den sie abstützenden erotischen Phantasien schuf sie sich selbst den haltenden Rahmen, den sie nicht vorfand, aber dennoch benötigte. In der zwanghaften Liebe ruht sozusagen ihre gesamte Entwicklung; sie stellt den Grund ihres psychischen Lebens dar, den sie gerade deshalb, weil er etwas Grundhaftes hat, nicht aufgeben kann. Indem die Patientin diese „Überlebens“-Methode in der Behandlung reproduziert – und das ist die zweite Bedeutung von „Drehpunkt“ – wird sie aktuelle Wirklichkeit. Damit wird es der Behandlung möglich, im Feld der Störung selbst zu operieren. Wir erhalten mit der intensiven Übertragungsliebe die Richtung reproduziert, die dem Leben der Frau einst Sinn gab, an der sie festhält und die sie zugleich in eine entwicklungsfördernde Drehung bringen möchte. Mit der Übertragungsliebe gerät die Drehgrenze der ganzen Konstruktion in unseren Wirkungsbereich. An ihr hat die Behandlung anzusetzen, die Entwicklung der Patientin muss durch dieses „Feuer“ hindurch. Eine Komplikation kann an dieser Stelle nicht übergangen werden. Freud war in der Regel der Meinung, dass sich die Übertragungen spontan, sozusagen ohne das Dazutun des Analytikers, einstellen. Nicht erst in der aktuellen Diskussion wird dagegen häufig die Auffassung vertreten, dass die Übertragung ein vom analytischen Setting hergestelltes, ein interaktionelles Phänomen sei. Diese Anschauung konnte sich in den letzten Jahren eine weitgehende Anerkennung verschaffen. Sie wird heute z. B. von Thomä/Kächele (1985) vertreten. Unter diesem Aspekt erscheinen die Übertragungen, die in der analytischen Situation zu beobachten sind, nicht als spontane, ohne Dazutun des Analytikers sich einstellende Wiederholungen des Patienten, sondern als gemeinsame Produktionen der an dem analytischen Unternehmen Beteiligten. Freud (1905) hatte, in seiner ihm eigentümlichen Art, den seelischen Gegenstand von verschiedenen Perspektiven her einzukreisen, diesen Gesichtspunkt implizit vertreten, wenn er einräumte, dass manche Übertragungserscheinungen nicht den Charakter von Neuauflagen, sondern eher von „Neubearbeitungen“ (280) hätten, oder wenn er von der Übertragungsneurose als von einer „artifiziellen Krankheit“ (1914, 135) sprach.
III
Die Grundform der psychoanalytischen Behandlung findet bei zwei bis fünf Wochenstunden über einen Zeitraum von mehreren Jahren statt. Sie wird daher hier „lange Analyse“ genannt. Von diesem Verfahren leiten sich verschiedene Formen der analytischen Kurztherapie ab. Sie basieren auf Theorie und Methode der klassischen, langen Psychoanalyse, suchen aber, durch die Betonung gewisser Züge und den Verzicht auf bestimmte Behandlungsziele, eine Verkürzung der Behandlungsdauer auf in der Regel zehn bis dreißig Wochen bei einer Sitzung pro Woche zu bewerkstelligen. Aus diesem Grunde werden diese Behandlungsformen hier „kurze Analyse“ genannt. Die „Intensivberatung“ (Salber 1980) ist solch eine kurze Analyse, die den Übergang zwischen Augenblick und Struktur eigens heraushebt und damit auf kurzfristige, intensivierte Eingriffe in begründeter Weise setzen kann. Zunächst möchte ich den Umgang mit der Übertragung in der langen Analyse beschreiben. Die lange Analyse ist in ihrem Setting von vornherein auf Entwicklung ausgerichtet. Zwar war man in den Anfängen der Auffassung, es komme lediglich darauf an, dem Patienten – nach einiger Zeit der Untersuchung – die Entstehungsbedingungen seiner Symptome mitzuteilen. Jedoch erwies sich dieses Modell als zu einfach. Mit der Zeit musste man erkennen, dass ein dauerhafter Erfolg nur dann herbeizuführen ist, wenn der Patient in einen bewegenden Umbildungsprozess gerät, bei dem Begrenzungen, Einschränkungen und Verstrebungen aufgelöst und neue, weniger festgelegte Umgangsformen eingeübt werden können. Die Analyse, als Deutung der Vergangenheit des Patienten, veränderte sich so zur Analyse von Widerstand und Übertragung. Die Analyse geht seitdem durch das Nadelöhr des Augenblicks hindurch; der Kampf um die Entwicklung wird an den in der analytischen Situation wirksamen Methoden und Widerständigkeiten geführt, wenngleich diese auch tief in der Vergangenheit verankert sein mögen. So kann Freud (1916–17) sagen: „Man hat darum auch mit Recht gesagt, die psychoanalytische Behandlung sei eine Art von Nacherziehung.“ (469) Die lange Analyse kann wirksam werden, wenn es gelingt, die zu Wiederholung und zwanghafter Durchsetzung tendierende Selbstbehandlung des Falles in einem gemeinsamen Regelwerk zur Sprache kommen zu lassen. Darauf zielen die ersten Bemühungen bei der Einleitung der Behandlung. Die Patienten leiden zwar darunter, dass sie den Anforderungen des alltäglichen Lebens nicht mehr in einer Weise begegnen können, die ihre Entwicklung in Gang zu halten versteht. Jedoch sind ihnen die Einschränkungen, die Festlegungen und Unverrückbarkeiten zum großen Teil nicht bewusst. Sie haben sich mit der Zeit ein Bild ihrer Lage gemacht, das von dem wirksamen Zusammenhang, der letztlich dafür verantwortlich zu machen ist, dass sie sich im Leben nicht mehr zurechtfinden, entscheidend abweicht. Sie stellen sich dem Analytiker von einer Seite dar, die diesen in die Irre führen soll und es ihnen ermöglichen soll, an ihrer neurotischen Lösung dennoch festzuhalten. Dieses geliebte Bild von sich selbst und der Welt, das sie in die Behandlung bringen, stellt den ersten zu überwindenden Widerstand dar. Er kann als „Widerstand gegen das Bewusstwerden der Übertragung“ (Thomä & Kächele 1985, 103) bezeichnet werden. Hierbei ist es zum einen erforderlich, dass es dem Analytiker gelingt, mit seiner Haltung eine Verfassung zu schaffen, innerhalb derer es der Fall wagen kann, ungeliebte Seiten und peinliche Regungen gegenüber dem Therapeuten zu erfahren und mitzuteilen. Gilli & Hoffmann (1982) haben untersucht, inwiefern das Verhalten des Analytikers dazu führt, den Widerstand gegen die Entfaltung der Übertragung zu motivieren und zu festigen. Nur wenn der Analytiker in seinem Verhalten zeigt, dass er grundsätzlich auf alles gefasst ist und nicht dazu neigt, die Gefühle des Patienten zu bewerten oder abzulehnen, kann dieser sich entspannen und es wagen, den Kern seiner Störung am Gegenüber des Therapeuten zu beleben. Ergänzt wird dieses Schaffen einer Verfassung, die ein erweitertes Ausdrucksgeschehen ermöglicht, durch gezielte Interpretationen der Maßnahmen gegen das Auswachsen der Übertragung. Man kann diesen Aspekt als die Analyse des Widerstandes gegen die Übertragung bezeichnen. Sie hat den Sinn, den unbewussten Regungen des Falles einen „Tummelplatz“ (Freud 1914, 134) zu eröffnen, auf dem sie schließlich angreifbar werden. Der nächste Schritt – des hier idealtypisch beschriebenen Verlaufes der langen Analyse – besteht in der Verstärkung und der Zentrierung der Übertragungsregungen, die sich zunächst punktuell und zögerlich einstellten. Oft wird der Analytiker auf diese durch Bewegungen aufmerksam, die sich in ihm selbst einstellen und deren Intensität ihn darauf verweist, dass er beginnt, auf die Tendenz des Falles zu reagieren, das gemeinsame Behandlungswerk unter das Regime seiner bestimmenden Techniken der Selbstbehandlung zu stellen. Daher werden diese Regungen im Analytiker auch „Gegenübertragungen“ (Freud 1910) genannt. Eine sich wiederholende sexuelle Erregung gegenüber einem Patienten kann ihn zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass dieser begonnen hat, die Behandlung in eine sexualisierte Gemeinsamkeit hineinzuziehen. Damit eröffnet sich ein kritischer Moment. Der Analytiker kann diese Regung in sich niederkämpfen und sich ganz auf die zu vermutende Erregung bei der Patientin konzentrieren und diese mit dem gebührenden Ernst beobachten. Wenn es jedoch in dieser Phase der Behandlung darum geht, die Übertragungen zur vollen Entfaltung zu bringen, tut er besser daran, dieser gemeinsamen Realität nicht entgegenzuwirken, sondern sie für sich zunächst anzunehmen und sie – in dem festen Vertrauen auf die Unumstößbarkeit der zu Beginn getroffenen Abmachungen, die eine reale Liebesbeziehung selbstverständlich ausschließen – anwachsen zu lassen. Das gilt selbstverständlich auch für die feindseligen Regungen des Patienten. Es war Winnicott (1949), der als einer der ersten darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Patienten den Hass des Analytikers benötigen, um selbst in die Lage zu geraten, hassen zu können. Unter Beibehaltung des vereinbarten Regelwerkes, das zum Beispiel auch festlegt, dass auf Handlungen in der Analyse verzichtet wird, arbeitet der Analytiker also der Tendenz zur Ausbreitung des Übertragungswerkes nicht entgegen, sondern fördert sie. Damit findet eine neue Zentrierung statt, die allem in der analytischen Situation Gesagten einen neuen Sinn verleiht. Die Behandlung findet ihr Zentrum in den Formen des Austauschs, die sich aktuell zwischen Fall und Analytiker herstellen. Man kann auch sagen, dass sich die vereinzelten Übertragungen zu einer „Übertragungsneurose“ (Freud 1914, 135) verdichten und zuspitzen. Damit ist eine neue Stufe der Behandlung erreicht, die auch neue Schwierigkeiten mit sich bringt. In keiner Phase tendiert die Behandlung so sehr dazu, ihre methodische Verdoppelung aufzugeben wie hier. Fall und Analytiker sind in eine gemeinsame Wirklichkeit eingebunden, deren Tendenzen auf ungebrochene Durchsetzung zielen, die sich in ein gemeinsames Handeln umzusetzen suchen. Das Regel- und Arbeitswerk droht von dem übertragenen Werk eingenommen zu werden. Freud (1912) befürchtet, dass die Übertragung den Patienten „aus seinen realen Beziehungen zum Arzte heraus schleudert“ (373). Und zugleich befürchtet er, dass der Analytiker nicht Herr seiner Gegenübertragungsregungen bleibt (Freud 1915). Es kommt hinzu, dass die Übertragungsneurose dazu tendiert, sich gegen jedwede Veränderung zu verschließen. Die seelischen Werke, die sich in der Not gebildet haben, tendieren dazu, sich gegen Umbildungen zu behaupten. Im Falle einer intensiven Übertragungsliebe z. B. möchte der Fall viel eher an der Aussicht festhalten, dass seine Sehnsüchte vom Analytiker handelnd befriedigt werden, als dass er bereit ist, auf diese starke Vorlust zu verzichten. Manchmal ist es auch der Analytiker, der die erotisierte Atmosphäre nicht aufgeben will. Im Falle von negativen Übertragungen erscheint – auf ähnliche Weise – die Aussicht auf eine rasche und gründliche Erledigung von störenden Beschränkungen anziehender und weniger aufwendig als die, für eine Entwicklung notwendigen, langwierigen Differenzierungen und Umgestaltungen. Die übertragenen Werke zeichnen sich durch eine gewisse Einfachheit und Direktheit aus, und man möchte nur ungern auf sie verzichten. Dieser „Widerstand gegen die Auflösung der Übertragung“ (Thomä & Kächele 1985, 103) stellt jetzt das größte Hindernis für den Fortgang der Behandlung dar. Die Analyse hat sich mit der Herausbildung der Übertragungsneurose selbst eine ihrer größten Schwierigkeiten geschaffen. Und doch ist mit dieser Intensivierung und Zentrierung der Störung um den Austausch zwischen Patient und Analytiker zugleich die Möglichkeit gegeben, einen anderen Ausweg aus den festgehaltenen Grenzen zu finden. Denn die Übertragung erweist den „unschätzbaren Dienst …, die verborgenen und vergessenen Liebesregungen der Kranken aktuell und manifest zu machen, denn schließlich kann niemand in absencia oder in effigie erschlagen werden“ (Freud 1912, 374). Es kommt in dieser Phase im Ganzen darauf an, dass die Behandlung zwischen zwei Werkzusammenhängen stattfindet, dass sie mit zwei verschiedenen Zentrierungen zu spielen in der Lage bleibt: die analytische Methode, die das Ziel verfolgt, die Störung des Falles zu verstehen, und das übertragene Werk des Falles mit der Tendenz, die analytische Situation ebenso wie die Alltagswirklichkeit unter seiner Perspektive rücksichtslos zu vereinheitlichen. In der Literatur erscheint das erstgenannte Werk unter unterschiedlichen Bezeichnungen. Freud meinte, dass die Zusammenarbeit von Fall und Analytiker durch eine „unanstößige Komponente“ (1912) der positiven Übertragung getragen sei. Fenichel (1941) gebrauchte den missverständlichen Begriff „rationale Übertragung“. Stone (1961) nannte es die „reife Übertragung“ und mit Greenson (1967) bürgerte sich für lange Zeit der Begriff „Arbeitsbündnis“ ein. (Zur Problematik all dieser Begriffe siehe Körner 1989.) Über die Bearbeitung der intensivierten Übertragung gibt es verschiedene Konzepte, von denen hier nur die drei wichtigsten angesprochen werden sollen. Freud (1914) vertrat die Auffassung, dass die auf Handlung drängenden Wiederholungen in Erinnerungen aus der Zeit umzuwandeln sind, in der die neurotische Entwicklung ihren Anfang genommen hat. In einem langfristigen Durcharbeiten geht es darum, der zwanghaften Durchsetzung der Übertragungserscheinungen durch ein vertieftes Verstehen ihrer Entstehung entgegenzuwirken. Die Übertragung erhält durch die Analyse eine genetische Begründung und wird im Fortgang ihrer Erforschung allmählich aufgelöst. Auf Strachey (1935) geht die Auffassung zurück, dass die weniger an harscher Abwehr orientierte Haltung des Analytikers gegenüber den Ansprüchen, die in der Übertragung geäußert werden, vom Patienten Stück für Stück übernommen wird und ihm allmählich ein beweglicheres Umgehen mit den in ihnen zum Ausdruck kommenden Regungen gestattet. In der zeitgenössischen Diskussion wird vermehrt die Auffassung vertreten, dass die aktuelle Bearbeitung der Übertragungskonflikte die entscheidende therapeutische Veränderung bewirkt. Damit wird der sogenannten „therapeutischen Beziehung“ (Thomä & Kächele 1985) oder der „Arbeit in der Übertragung“ (Körner 1989) die wesentlich verändernde Wirksamkeit in der analytischen Behandlung zugesprochen. In der Auseinandersetzung mit dem Analytiker, mit dessen persönlicher Haltung und Methode, erobert sich der Patient beweglichere Formen der Wirklichkeitsgestaltung und lernt, auf die eingeschliffenen Muster zu verzichten. Er gerät in der Behandlung in die Lage, im Analytiker einen „Anderen“ zu erkennen (Weiss 1988). Im Idealfall wird die lange Analyse in einem Zustand beendet, in dem der Austausch zwischen Patient und Analytiker nicht mehr durch wiederholte Muster bestimmt wird. Diese Auffassung schließt ein, dass auch der Analytiker in – für ihn mitunter bedeutsame – Umbildungen einbezogen wird. Formulierungen Freuds, die von der Übertragung als „Zwischenreich“, als „artifizieller Krankheit“ (1914, 135) sprechen oder sie mit der Kambiumschicht der Baumrinde vergleichen, von der die Gewebsneubildung und das Dickenwachstum ausgeht (1916–17, 462), deuten bereits in diese Richtung.
IV
Die Bemühungen, die in der Regel einige Jahre dauernde analytische Behandlung abzukürzen, gehen auf Versuche von Freud selbst, Ferenczi und Rank zurück. Heute gibt es eine beträchtliche Anzahl von Analytikern, die – gegen den Strom einer großen Skepsis bei den meisten ihrer Kollegen – kurze Analysen durchführen (Malan 1963, Bellak & Small 1972, Sifneos 1972, Davanloo 1980, Leuzinger-Bohleber 1985). In der Regel wird die Auffassung vertreten, dass man auch im Rahmen der Kurzbehandlung auf die Arbeit mit der Übertragung nicht verzichten kann. Zum einen ist nicht zu vermeiden, dass sie sich bemerkbar macht. Zum anderen ist sie ein wertvolles Instrument, das die Konstruktionsprobleme der Fälle beobachtbar und beeinflussbar werden lässt. Für die Psychotherapie bedeutet es einen praktischen und einen Erkenntnisgewinn, wenn sie sich auf die Muster bezieht, die im methodisch abgesteckten Rahmen der Behandlung das Handeln und das Erleben des Falles durchformen. Geht dieser erlebensnahe Bezug zum Strukturellen verloren, droht die Behandlung – insbesondere bei bestimmten Patienten – zu einem Gespräch zu werden, bei dem zwar vieles angesprochen werden mag, aber letztlich doch nichts bewegt wird. Im Allgemeinen ist die Auffassung über die Handhabung der Übertragung in der kurzen Analyse dadurch geprägt, dass die lange Analyse als das Grundverfahren betrachtet wird und die kurze Analyse als eine unvollständige Version derselben. Man weiß aus dem klassischen psychoanalytischen Verfahren, der langen Analyse, dass die sich in einer Übertragungsneurose intensivierenden Muster viel Zeit benötigen, um a) sich überhaupt herauszubilden und b) wieder aufgelöst zu werden. Zudem weiß man auch, dass sich die verschiedenen Seiten oder Schichtungen der Störung nur in einem zeitaufwendigen Nacheinander aktualisieren lassen. So wird der Unterschied zwischen einer kurzen und einer langen Behandlung in der Regel durch ein „mehr“ oder ein „weniger“ charakterisiert. Die Beschreibung der Handhabung der Übertragung in der kurzen Analyse leitet sich aus einer negativen Abgrenzung zur langen Analyse ab. Leuzinger-Bohleber (1985) sagt, in der kurzen Analyse komme es „nicht zu einer eigentlichen Übertragungsneurose …, sondern lediglich zu Übertragungsphänomenen“ (25, Hervorh. von D. B.). Daher müssten die Übertragungen früher angesprochen werden als in der langen Analyse. Schon vage Manifestationen würden gedeutet und mit aktuellem oder vergangenem Material verknüpft. Auf die Entwicklung einer Übertragungsneurose werde in der kurzen Analyse verzichtet, da der Zeitrahmen hierfür nicht ausreiche. Ist jedoch eine kurze Behandlung notwendig eine „kurze Analyse“? Oder lässt sich der Behandlungsprozess in einer Weise fassen, in der eine Verkürzung des analytischen Prozesses mehr ist als eine unvollständige Analyse von Widerstand und Übertragung? Mit der „Intensivberatung“ (Salber 1980) ist ein Konzept psychologischer Kurzbehandlung gegeben, das es erlaubt, die kurze Analyse als eine eigenständige Behandlungsform zu beschreiben und sie damit aus der Notwendigkeit zur negativen Abgrenzung von der langen Analyse zu befreien. Die Intensivberatung geht davon aus, „dass es keine ‘tiefere’ Sinngebung für Verwandlung gibt als die Entwicklung von Werken, die im Übergang und in unserer Übergangszeit aus der so konstruierten Wirklichkeit ‘das Ihre’ und ‘das Beste’ machen“ (Salber 1980, 133). Der zu behandelnde Fall wird von vornherein als ein Werk aufgefasst, das in sich sowohl Problem, missglückten Lösungsversuch als auch Entwicklungschancen trägt. Das aktuelle Verhalten und Erleben des Falles bringt eine Konstruktion zum Ausdruck, die über intensivierte Beschreibung, Zerlegung und Typisierung rekonstruierbar ist. Der Übergang von Phänomen in Struktur und der methodische Zusammenhang von Beschreibung und Rekonstruktion erlauben es, bei der Intensivberatung von einer „Strukturbehandlung“ zu sprechen. Sie zielt von Anbeginn darauf, ein in den Einfällen, Erinnerungen, Erzählungen und Taten des Falles wirksames Bild herauszuheben und damit dem gelebten Werk einen entwicklungsfördernden Ruck zu versetzen. Die gelebte Struktur – als Gebilde gefasst – wird in einem intensivierten Modellierungsprozess mit sich selbst konfrontiert und darüber aus den eingeschliffenen Lagerungen herausgerückt. Ich möchte zum Abschluss vier wesentliche Merkmale von langer Analyse und Intensivberatung herausstellen, die den unterschiedlichen Umgang der beiden Verfahren mit den Übertragungsphänomenen bestimmen. Dabei knüpfe ich an eine frühere Untersuchung zur Unterscheidung von Psychoanalyse und Intensivberatung an (Blothner 1986).
V
In der langen Analyse findet die Entwicklung des Falles unter den Augen des Analytikers statt und ist an den veränderten Formen des Umgangs zwischen Fall und Analytiker beobachtbar. Alle Manifestationen, die mit der Störung zusammenhängen, werden auf den zwischen ihnen bestehenden Austausch bezogen. Dem Fall wird ein „realer“ Spielraum eröffnet, in dem er in eine gemeinsame Entwicklung mit einem bedeutungsvollen Anderen zu treten vermag. Somit liegt der Dreh- und Angelpunkt der therapeutischen Veränderung bei der langen Analyse in dem Feld zwischen Fall und Analytiker. Ob man dieses aus der Kindheit des Falles zu verstehen sucht oder ob man mehr auf dessen aktuelle Gestaltungsprobleme fokussiert: Die Veränderung erwächst aus der Analyse des Werkes, das sich in und während der analytischen Begegnung konstelliert. Das „Jetzt hier“, in das Patient und Therapeut involviert sind, ist das Nadelöhr, durch das die Entwicklung hindurch muss. Die Vielfalt der Phänomene in der lang ausgedehnten Behandlung erhält hierdurch eine erlebensnahe Zentrierung. In der Intensivberatung ist es weniger der Analytiker, der als Medium der auf Wiederholung drängenden, neurotischen Methoden fungiert. Es ist eine Intensivierung der Bilderwirklichkeit (Salber 1983), die die Zentrierung der Behandlung um eine Übertragungsneurose ersetzt. Die Intensivberatung zielt von Anfang an darauf, den von ihr in Gang gesetzten Prozess um Bildhaftes und Bilder zu zentrieren, in denen das Behandlungswerk einen symbolischen Ausdruck erhält. Die aktuellen Taten, die Geschichten und Erlebnisse werden von Bildern her typisiert und erhalten über sie ihren Platz im Ganzen zugewiesen. Sie werden im Austausch mit Bildern beschrieben, ergänzt und verrückt. Es ist in der Regel ein Märchen (Salber & Rascher 1986, Salber 1987), in dem das, was sich in der Beratung als wirksam zu erkennen gibt, einen anschaulichen Ausdruck erhält. Wenn die Behandlung denjenigen Wendepunkt erreicht hat, in dem das Problem des Falles eine solche Spiegelung erfährt, erlebt sie ihre intensivste Vereinheitlichung (Ins-Bild-Rücken). Das Märchenbild wird von nun an zur gemeinsamen Wirklichkeit, auf die Fall und Analytiker sich beziehen, die sie sich gegenüberstellen und in der sie ihre Regungen, Hoffnungen und ihr Leiden wiedererkennen. Das die Behandlung vereinheitlichende Bild ist die Begründung dafür, dass auf die Entwicklung der Übertragungsneurose verzichtet werden kann. Es ist auch die Gewähr dafür, dass die Intensivberatung – eher als die lange Analyse – der Gefahr entgeht, dass Fall und Analytiker sich in nur schwer und mit viel Zeitaufwand aufzulösenden Verstrickungen verfangen. In „Die endliche und die unendliche Analyse“ stellt Freud (1937) die Frage, ob es sinnvoll beziehungsweise möglich sei, in der Analyse unbewusste Konflikte zu beleben, die sich dort selbst nicht beobachten lassen. Da die Psychoanalyse weiß, dass die Liebesbindungen einen grundsätzlich ambivalenten Charakter haben, erscheine es doch angebracht, in der Übertragungsliebe bereits den Übertragungshass zu vermuten und zu versuchen, diesen zu bearbeiten, wenn sich sein Gegenstück – die Liebe – in der Beziehung zum Analytiker breitgemacht hat. Es gilt heute als sicher, dass sich Freud hiermit einem an ihn gerichteten Vorwurf Ferenczis befasst, der seinem Lehranalytiker vorgeworfen hatte, bei ihm die negative Übertragung nicht analysiert zu haben, um sich so die Ergebenheit des Schülers zu erhalten (vgl. Thomä & Kächele 1985). Freud wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Es sei nicht möglich und auch nicht zu vertreten, schlafende Konflikte vorzeitig aufzuwecken. Die Analyse habe kein natürliches Ende. Sie könne nur an dem ansetzen, was seine Wirksamkeit dem bewussten Erleben mitteilt. Seien keinerlei Anzeichen – auch die verstecktesten nicht – einer negativen Übertragung beobachtbar, könne man diese auch nicht analysieren. Diese Antwort Freuds auf den Vorwurf Ferenczis zeigt, dass die lange Analyse das in die Behandlung versetzte Lebenswerk gleichsam „aufzuwickeln“ sucht. Sie versteht die Arbeit mit Widerstand und Übertragung als einen sich während der Behandlung vollziehenden Entwicklungsprozess. Sie setzt an den aktuellen Manifestationen der Störung an, sucht deren Motivation zu verstehen, ruft damit Übertragungen auf den Plan, die wiederum andere Seiten oder Versionen der Störung beleben. Diese werden nun freigelegt, damit sie sich deutlicher manifestieren können. Wenn die neuen Erscheinungen verständlich geworden sind, beziehungsweise wenn der ihnen zugrundeliegende Konflikt bearbeitet ist, werden sich wiederum neue Seiten zeigen usf. Die gelebte Wirklichkeit wird als eine komplizierte, vielschichtige Konstruktion aufgefasst, deren Analyse ein tendenziell „unendliches“ Verfahren darstellt. Klüwer (1985, 105) sucht dieses Verhältnis von Aktualität und Struktur in dem – leider statischen – Bild eines ausgedehnten Kellergewölbes zu fassen, in das man nur durch die Eingangstür eintreten könne und bei dem man immer nur einen Raum nach dem anderen zu erkunden in der Lage sei. Die Intensivberatung strebt einen solchen Entwicklungsgang nicht an. Der Rahmen von ein bis drei Blöcken zu zwanzig Stunden ließe das auch nicht zu. Sie kann den Fall bei seiner Entwicklung nur sehr begrenzt begleiten. Sie zielt mehr darauf, ihm einen Anstoß zu einer weiterführenden Entwicklung zu vermitteln. Sie setzt auf einen heftigen, aufstörenden „Ruck“. In intensivierter Untersuchung werden die Ausmaße des behandelten Werkes eingekreist und deren Bestandteile herausgerückt, teilweise herausgestaltet. Hierbei wird mehr ein Querschnitt durch das Störungswerk hergestellt, als eine Längsschnitt-Entwicklung verfolgt. Es gibt dabei keine eindeutige Priorität der Wertigkeit des Materials. Erzählungen, aktuelle Übertragungen, Geschichtliches werden gleichermaßen herangezogen, um das zu behandelnde Verkehrthalten kenntlich zu machen. In einem gezielten und präzise angelegten Zugriff soll die Drehgrenze einer fixierten Struktur erfasst und verrückt werden. Die Übertragungserscheinungen werden dabei nicht vernachlässigt, aber auch nicht gesteigert und verdichtet. Ebenso wie das andere Material werden sie herausgehoben, beschrieben, typisiert und in Analogie zu anderen Produktionen des Falles gesetzt. Damit stellt die Intensivberatung der langfristigen Entwicklungsarbeit das Provozieren heftiger Umbrüche, forcierter Zerlegungen und karikierender Beschreibungen gegenüber. Sie gewinnt damit im Ganzen einen anderen Charakter, einen anderen Stil der Bearbeitung. Viel stärker als die lange Analyse beruft sie sich auf Methoden, wie sie aus der modernen Kunst her anschaulich bekannt sind: Extremisierungen, Störungen, Umbrüche, Zuspitzungen und Umschwünge. Dem Auf-Wickeln von mehrschichtigen Werken, wie es die lange Analyse betreibt, setzt die Intensivberatung den Schock einer intensivierten Verrückungsmethode entgegen.
VI
Es wird nur selten berücksichtigt, welch unverzichtbaren Formanhalt die Umgangsformen des guten Benimms, die Vor-Bilder der Werbespots und Spielfilme, aber auch die Höflichkeiten der Mitmenschen oder die Verlässlichkeit der Straßenbahn dem Alltagsleben verleihen. Kultur und Alltag bilden eine Einheit, die das ausgedehnte Getriebe unserer Lebenswirklichkeit in Gang hält, an die wir jeden Morgen wieder Anschluss gewinnen und von der wir uns über weite Strecken tragen lassen können. Einer genaueren Beobachtung kann jedoch nicht entgehen, dass der scheinbar verlässlich funktionierende Alltag durch andere Wirkungskreise immer wieder durchkreuzt wird. Trotz aller Formen und Stützen, auch trotz der durch die mannigfachen Einrichtungen der Kultur nahegelegten Beweglichkeit kommt es in unserem Leben immer wieder zu verwirrenden Zuspitzungen, Explosionen und Teufelskreisen. Nehmen solche Tendenzen überhand, machen sie darauf aufmerksam, dass sich der Alltag nicht mehr entwickeln lässt und dass sich Werkszwänge durchsetzen, die seine Vielfalt nach immer gleichem Muster zu vereinheitlichen suchen. Es wird dann offensichtlich: In unsere alltäglichen Taten und Leiden schieben sich Bilder, die – um mit Freud (1920) zu sprechen – durchaus „dämonische“ Züge haben. Sie sind aus der Not geboren und bedeuten durchaus nicht das Glück, doch ihnen zur Seite steht die Faszination an schnellen und einfachen Lösungen, steht die Verheißung von Besessenheit und traumhafter Lust.
Die analytische Behandlung zielt auf die Veränderung dieser sich zwanghaft durchsetzenden Methoden. Sie möchte sie durch beweglichere Umgangsformen ersetzen. Indem sie ihre Fälle in einen Regelrahmen versetzt, der auf weitestgehende Ausdrucksbildung nur durch Worte drängt, gelingt es ihr, diese zu mannigfachen Störungen Anlass gebenden Bilder aufzuspüren, kenntlich zu machen und zu bearbeiten. Es ist immer wieder überraschend zu beobachten, wie wenig die meisten Menschen selbst entwickeln können, wenn man ihnen Stützen wie Arbeit, Partner, Fernsehen, Drogen und Streitgespräche entzieht. Im Alltag setzen sich die Menschen nur so weit einem solchen Entzug aus, als sie ihn ohne größere Beunruhigung ertragen können. In der analytischen Behandlung werden sie dazu angehalten, ihre Toleranz gegenüber den eigenen ungeliebten Anteilen ein wenig weiter auszudehnen. Die sich dann zwangsläufig abhebenden, kurzschlüssigen Methoden werden seit Freud (1895) als Übertragungen i. e. S. bezeichnet, da er davon ausgeht, dass diese in der Behandlung gegenüber dem Analytiker zum Ausdruck gebrachten Umgangsformen an früheren Bezugspersonen eingeübt worden sind. Man kann die Übertragungen in das Zentrum der Behandlung stellen und sie zur vollen Blüte ausreifen lassen (Regression). Die lange Analyse, die dies anstrebt, erhält dadurch eine für die Beteiligten spürbare Vereinheitlichung und Zentrierung, die dem Behandlungsprozess einen starken Realitätscharakter verleiht. Allerdings bringt sie sie damit auch in die Gefahr, sich aus den entstehenden Verstrickungen nicht mehr lösen zu können. Man kann die Behandlung um vereinheitlichende Bilder zentrieren, die Übertragungen in ihren Keimformen, Ansätzen belassen und sie vornehmlich als überzeugende Veranschaulichungen der Gesamtkonstruktion heranziehen. Hiermit erspart man sich Komplikationen, welche die Behandlung gefährden, und ermöglicht zudem eine gehörige Abkürzung des gesamten Prozesses. Es ist die Intensivberatung, die diese Alternative favorisiert. Auch lassen sich die kurzschlüssigen Methoden Stück für Stück in einen Umbildungsprozess einbeziehen, in dessen Verlauf „Entwicklung“ als Methode eingeübt wird. Die lange Analyse ist ein Verfahren, das solch einen begleiteten Veränderungsprozess ins Werk setzt. Zwar ist dieser in der Regel tiefgreifend, aber auch sehr langwierig, und es lässt sich zu Beginn nicht immer sicher einschätzen, ob der enorme Aufwand sich tatsächlich lohnt. Die Intensivberatung möchte solch einen „epischen“ Entwicklungsprozess nicht einleiten. Damit schließt sie gewisse Fälle von vornherein aus, bei denen nur eine Nachentwicklung zu spürbaren Veränderungen führen kann. Indem sie aber dem allmählichen Entwickeln einen kurzfristigen Aufruhr von intensivierten Verrückungen entgegensetzt, gelingt es ihr, in kürzerer Zeit den Fall aus den festgehaltenen Drehgrenzen herauszulockern.
Zusammenfassung
Die Handhabung der Übertragung ist ein zentraler Drehpunkt der klassischen Psychoanalyse. Wie die anderen analytischen Kurzbehandlungen auch kann die Intensivberatung die notwendig langwierige Analyse der Übertragung nicht zum Hauptransatzpunkt ihres Verfahrens machen. Während aber die analytische Kurztherapie in der Regel als eine „kurze“, d. h. unvollständige Analyse beschrieben wird, stellt die Intensivberatung Konstruktionszüge von Behandlung heraus, die ihr das Profil einer eigenständigen Behandlungsform verleihen.
Hinweis:
Dieser Artikel ist eine Neuauflage und wurde per Hand ins Digitale übertragen sowie an die neue Rechtschreibung angepasst. Wir bitten um Nachsicht für eventuelle Fehler.
Bellak, L., & Small, N. (1972). Kurzpsychotherapie und Notfallpsychotherapie. Frankfurt am Main.
Blothner, D. (1986). Intensivberatung und lange Psychoanalyse. Zwischenschritte, 1, 21–32.
Davanloo, H. (Hg.). (1980). Short-term dynamic psychotherapy. New York.
Fenichel, O. (1941). Problems of psychoanalytic technique. Psychoanal. Quart. Inc., New York.
Freud, S. (1895). Studien über Hysterie. GW I. London 1940 ff.
Freud, S. (1905). Bruchstück einer Hysterieanalyse. GW V. London 1940 ff.
Freud, S. (1910). Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie. GW VIII. London 1940 ff.
Freud, S. (1912). Zur Dynamik der Übertragung. GW VIII. London 1940 ff.
Freud, S. (1914). Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten. GW X. London 1940 ff.
Freud, S. (1915). Bemerkungen über die Übertragungsliebe. GW VIII. London 1940 ff.
Freud, S. (1916–1917). Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. GW XI. London 1940 ff.
Freud, S. (1919). Wege der psychoanalytischen Therapie. GW XII. London 1940 ff.
Freud, S. (1920). Jenseits des Lustprinzips. GW XIII. London 1940 ff.
Freud, S. (1937). Die endliche und die unendliche Analyse. GW XVI. London 1940 ff.
Freud, S. (1960). Briefe 1873–1939. Frankfurt am Main.
Gill, M. M., & Hoffmann, J. Z. (1982). Analysis of transference. Vol. II: Studies of nine audio-recorded psychoanalytic sessions. New York.
Greenson, R. R. (1967). Technik und Praxis der Psychoanalyse (Bd. 1). Stuttgart 1973.
Körner, J. (1989). Arbeit an der Übertragung? Arbeit in der Übertragung! Forum Psychoanal., 5, 209–223.
Klüwer, R. (1985). Versuch einer Standortbestimmung der Fokaltherapie als einer psychoanalytischen Kurztherapie. In M. Leuzinger-Bohleber (Hg.), Psychoanalytische Kurztherapien (S. 94–113). Opladen.
Leuzinger-Bohleber, M. (Hg.). (1985). Psychoanalytische Kurztherapien. Opladen.
Malan, D. H. (1963). Psychoanalytische Kurztherapie. Stuttgart 1965.
Salber, W. (1980). Konstruktion psychologischer Behandlung. Bonn.
Salber, W. (1983). Psychologie in Bildern. Bonn.
Salber, W. (1987). Psychologische Märchenanalyse. Bonn.
Salber, W., & Rascher, G. (1986). Märchen im Alltag. Köln.
Sifneos, P. E. (1972). Short-term psychotherapy and emotional crisis. Cambridge, Mass.
Stone, L. (1961). Die psychoanalytische Situation. Frankfurt am Main 1973.
Strachey, J. (1935). Die Grundlagen der therapeutischen Wirkung der Psychoanalyse. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 21.
Thomä, H., & Kächele, H. (1985). Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie. Bd. 1: Grundlagen. Berlin, Heidelberg.
Weiss, H. (1988). Der Andere in der Übertragung. Stuttgart-Bad Cannstatt.
Winnicott, D. W. (1949). Hass in der Gegenübertragung. In D. W. Winnicott, Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse (S. 75–88). München 1976.
Autor:in
Dr. Dirk Blothner
Psychologisches Institut II der Universität Köln
Arbeitsschwerpunkte: Psychoanalyse, Intensivberatung, Filmwirkung
Veröffentlichungen zu „Psychoanalyse und Intensivberatung“, „Psychologische Diagnostik in der Klinik“, „Der amerikanische Freund“, „Carmen“