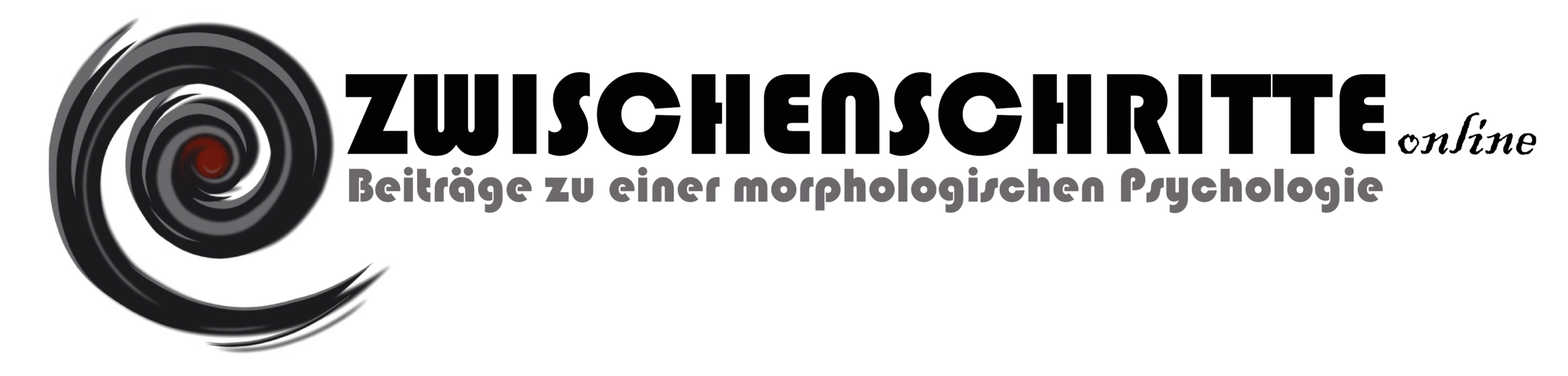Intensivberatung und lange Psychoanalyse [Reprint]
Prof. Dr. Dirk Blothner (1986)
Autor:in
Dr. Dirk Blothner
Psychologisches Institut II der Universität Köln
Arbeitsschwerpunkte: Psychoanalyse, Intensivberatung, Filmwirkung
Veröffentlichungen zu „Psychoanalyse und Intensivberatung“, „Psychologische Diagnostik in der Klinik“, „Der amerikanische Freund“, „Carmen“
Intensivberatung und lange Psychoanalyse
„Behandlung von der Seele aus …!“ (S. Freud 1905) — das ist die gemeinsame Grundlage von sowohl langer Psychoanalyse (im Weiteren als Analyse bezeichnet) als auch Intensivberatung. Das heißt zum einen, dass es darum geht, den Behandlungsspielraum des Seelischen gegen seine eigenen verkehrten Lösungen zu wenden, ohne auf Anleihen zurückzugreifen, die nicht von der seelischen Wirklichkeit her konzipiert sind. Zum anderen impliziert das, dass sich die psychische Realität schon immer in „Behandlungsprozessen“ befindet, auch ohne unsere Eingriffe. S. Freud hat diesen Aspekt der Selbstbehandlung des Psychischen besonders in seinen späteren Werken deutlich gemacht. Er kam in seinen metapsychologischen Überlegungen schließlich dahin, der Wirklichkeit eine paradoxe Grundkonstruktion von Einigen und Trennen, Bindung und Destruktion, Eros und Thanatos zugrunde zu legen (S. Freud 1914, 1920). Im Rahmen dieses Konzeptes verstand er sowohl den allgemeinen Selbstbehandlungsprozess des Seelischen als auch dessen Behandlung im engeren Sinne als ein letztlich „unendliches“ Unternehmen. Die dem Seelischen inhärenten unlösbaren Probleme und Konflikte lassen einen Abschluss, eine endgültige Lösung nicht zu. Jede Form, die sich bildet, trägt in sich notwendigerweise den Keim zu ihrer Auflösung. Jedes gelöste Problem wirft ein anderes auf, das zu neuen Lösungsversuchen herausfordert. Wegen dieser Grundkonstruktion des Psychischen fand er es sehr schwer, eindeutige Angaben über das Ende einer Analyse zu machen. (Siehe Freud 1937) Diesen Grundgedanken der Unendlichkeit des Problemlösens führt W. Salber in Begriffen wie „Versalitätsproblem“, „Gestaltverwandlung“, „ungeschlossene Geschlossenheit“ weiter aus. Er versteht das Seelenleben explizit als „Selbstbehandlung von Wirklichkeit“, die von paradoxen Grundproblemen sowohl in Gang gehalten als auch in ihren Formenbildungen strukturiert wird (W. Salber 1980). Er macht deutlich, dass Behandlung nicht im Sprechzimmer des Analytikers beginnt, sondern an die Formen und Methoden von Selbstbehandlung anknüpft, die wir auch in alltäglichen Verrichtungen beschreiben können. Der Unterschied zwischen allgemeiner Selbstbehandlung und klinischer Behandlung besteht zunächst einmal darin, dass letztere sich bewusst Regelungen auferlegt, die ein methodisches Vorgehen sicherstellen. Als Leitfaden für die dezidierte Zergliederung von psychologischer Behandlung greift W. Salber (1977) die Wirkungsformen von Kunst auf. Denn sie machen sowohl die Formen der allgemeinen Selbstbehandlung zugespitzt beschaubar, als sie auch der Behandlung im engeren Sinne Methoden des Verrückens festgefahrener Formen von Selbstbehandlung an die Hand geben.
Selbstbehandlung des Seelischen und die Unendlichkeit des Problemlösens sind der konzeptionelle gemeinsame Nenner von Psychoanalyse und Intensivberatung, der es gestatten soll, diese beiden Formen der Behandlung miteinander zu vergleichen. Man kann bekanntlich nicht Birnen mit Äpfeln verrechnen. Die beiden Ansätzen gemeinsame streng psychologische Auffassung, sowohl der Wirklichkeit überhaupt als auch der Wege zu ihrer therapeutischen Veränderung, lässt es jedoch zu, nach gemeinsamen Strukturzügen zu suchen, in Bezug auf welche Analyse und Intensivberatung vergleichbar sind. „Behandlung von der Seele aus“, mit den Mitteln, die das Seelische bereitstellt — das bildet die Basis dieses Vergleichs. Notwendigerweise wird es bei so verwandten, aber doch unterschiedlichen Konzepten, wie es Psychoanalyse und Morphologische Psychologie nun einmal sind, zu unterschiedlichen Akzentuierungen der Strukturmomente kommen, die in Hinblick auf eine Veränderung seelischer Selbstbehandlung als wesentlich angenommen werden. Bevor diese im Einzelnen dargestellt werden, sollen zunächst die miteinander zu vergleichenden Konzepte klinischer Behandlung, auch mit den Worten ihrer Schöpfer, kurz vorgestellt werden. Die Intensivberatung ist aus umfangreichen Arbeiten auf dem Gebiet der Wirkungsforschung (Film, Literatur, Medien, Alltag), insbesondere aber aus der Analyse des Wirkungsprozesses von bildender Kunst hervorgegangen. Sie macht es sich zur Aufgabe, die „verkehrtgehaltenen“ (neurotischen) Selbstbehandlungsformen in einem intensivierten Behandlungsgang wieder in Entwicklung zu bringen. Dabei lässt sie sich von dem Konzept der bildhaften Konstitution des Seelischen leiten, demgemäß sich das psychische Geschehen immer schon in Bildern organisiert (Salber 1983). Übertragen auf das Problem von Behandlung bedeutet das, dass die Selbstbehandlung dazu neigt, sich in Bildern einzugrenzen, die überschaubar erscheinen, die gewisse schmerzhafte Wendungen der Verwandlung auszugrenzen suchen. Das Seelische teilt auf diese Weise, um sich vor erschreckenden Verkehrungen zu schützen, die Wirklichkeit auf in ein „vertrautes Hauptbild“, in dem es sich zu Hause fühlen kann, und in ein eher dunkles, unkonturiertes „Gegenbild“, in dem all die unfassbaren und bedrohlichen Wirklichkeitsanteile zusammengefasst sind, die nicht in den gelebten Kreis von Verwandlung einbezogen werden sollen. Die Intensivberatung strebt nun an, in einem Zeitraum von 20 Stunden (1 Stunde pro Woche) diese Festlegung auf ein Hauptbild erfahrbar zu machen und Voraussetzungen zu schaffen, dass es zu einer Aussöhnung mit den im ungeliebten Gegenbild festgebannten Anforderungen von Verwandlung kommen kann. Dabei versteht sich die Intensivberatung als „Strukturbehandlung“, und dieses Selbstverständnis ist die Grundlage dafür, dass von einer „Intensivierung“ von Behandlung gesprochen werden kann. „Strukturbehandlung“ heißt, dass die Intensivberatung versucht, die Erfahrung umzusetzen, „dass es keine ‚tiefere‘ Sinngebung für Verwandlung gibt als die Entwicklung von Werken, die im Übergang und in unserer Übergangszeit aus der so konstruierten Wirklichkeit ‚das Ihre‘ und ‚das Beste‘ machen“ (W. Salber 1980, 133, Hervorhebung vom Verfasser). Die zu behandelnde Wirklichkeit wird also von vornherein als Werk-verfasst gesehen, als ein Gebilde, das in sich sowohl Problem, verkehrten Lösungsversuch und Entwicklungschancen trägt. Hiermit wird der Blick auf das aktuell funktionierende Ganze des Falles gelenkt, das danach strebt, den ganzen Raum der Beratung auszufüllen, an dessen Schaltstellen und Drehpunkten die Behandlung ansetzen kann. Der konzeptionelle Übergang von Phänomen in Struktur und der methodische Zugang von der Beschreibung zur Rekonstruktion erlauben es also, von einer „Strukturbehandlung“ zu sprechen, die mit bedeutend weniger Zeit auskommt als die Analyse. Wenn letztere bemüht ist, das Aktuelle aus den „Erinnerungen“ (genetische Rekonstruktion) zu verstehen, nimmt sie sich die Wucht, die entstehen kann, wenn man es als Ausdruck eines sich in der Übergangsstruktur erhaltenden und abwandelnden Werkes auffasst. Um das Besondere der Intensivberatung aber noch deutlicher zu machen und damit die Voraussetzungen für ihre Wirksamkeit zu kennzeichnen, soll sie noch etwas näher dargestellt werden. W. Salber (1980, 132) fasst zusammen, dass sich diese besondere Werkgestalt von Behandlung im engeren Sinne entwickeln lässt, wenn die gemeinsame Produktion typisiert wird, wenn ihre Wirkungen in Versionen herausgerückt werden, wenn die in Frage stehende Konstruktion in ihren Paradoxien kunstanalog zugespitzt wird und wenn damit ein Ruck mit Konsequenzen herbeigeführt wird. Diese vier Züge können als strukturelle Kennzeichen der besonderen Behandlungsform Intensivberatung angesehen werden. Die Typisierung greift die bildhafte Grundkonstruktion des Seelischen auf. Indem alle Tätigkeiten und Erlebensqualitäten im gemeinsamen Werk der Behandlung typisierend beschrieben und modelliert werden, erhält ihr Prozess einen bindenden Zusammenhalt und eine anschauliche Grundlage. Indem die vier Versionen von Leiden-Können, Methodisch-Werden, Ins-Bild-Rücken und Bewerkstelligen zum Leitfaden der Behandlung genommen werden, sind Kontrollen eingebaut und bekommt die Entwicklung des Falles eine methodische und sachliche Leitlinie, die Zerfaserungen vermeiden hilft. Mit der kunstanalogen Zuspitzung ist eine Intensivierung der Erfahrung der eigentümlichen seelischen Wirklichkeit gegeben. Hierdurch werden Betroffenheiten begünstigt und anders zentrierende Blickrichtungen herausgefordert. Mit dem Bewerkstelligen eines Rucks, der spürbare und sichtbare Folgen nach sich zieht, ist die Veränderung angestrebt, die im Rahmen des gegebenen Settings möglich ist. Es handelt sich um das „Herausrücken einer bestimmten Veränderung zwischen Bild und Nebenbild“ (Salber 1984, 101), das die strukturelle Grundlage für anderslaufende Entwicklungen darstellt. Ein altes Bild soll „erschüttert“ werden, und es sollen erste Versuche begleitet werden, die Probleme der Wirklichkeit von einer anderen Seite her anzugehen. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Intensivberatung nicht den Anspruch hat, den Fall „umzuwälzen“, in ihn dergestalt einzugreifen, dass die Art seiner Probleme eine ganz andere wird. Sie stellt sich lediglich das Ziel, die Formen zu verrücken, in denen der Fall mit seinen Problemen umgeht. Analysen finden mindestens seit 90 Jahren statt. In diese Zeit fallen sowohl erste Versuche der „Behandlung von der Seele aus“ als auch die zahlreichen Erweiterungen und Variationen ihres klassischen Kerns. Cremerius stellt (1982) fest, dass „die psychoanalytische Gemeinschaft ein Dach ist, unter dem heterogene Gruppen gemeinsam wohnen können“ (495). Das liegt nicht zuletzt daran, dass zunehmend Störungen in Behandlung kommen, die zu Freuds Zeiten als durch Psychoanalyse nicht erreichbar angesehen wurden (Psychosen, Borderline-Fälle, Psychosomatosen). Um der Klarheit der Darstellung willen möchte ich mich bei dem hier zu leistenden Vergleich auf das Grundkonzept von Analyse beschränken, das für Störungen anwendbar ist, die vor allem auf psychischen Konflikten begründet sind. A. Freud (1979) meint, dass „Entwicklungsstörungen“, und das sind jene, die nun mehr und mehr in den Anwendungsbereich der Psychoanalyse geraten, auf die klassische Form der Analyse „nicht ansprechen“ (2740). Solche Fälle leiden primär an unvollständigen Entwicklungsprozessen und sind deshalb nicht in die Lage gekommen, solch ein hochorganisiertes Gebilde wie eine „Neurose“ herauszubilden. Die Verhältnisse erscheinen aber noch schwieriger, wenn man andererseits berücksichtigt, dass sich die meisten Analytiker darin einig sind, dass letztlich wohl keine konkrete Analyse eines Falles in der klassischen Form durchgeführt werden kann, wie sie hier dargestellt wird (Eissler 1960). Viele psychoanalytische Autoren plädieren dafür, die Dimension der „Entwicklungsstörung“ in jedem Falle im Auge zu behalten. Diese komplizierten Verhältnisse darf man nicht übersehen, wenn über das Kernkonzept der Analyse gesprochen wird — es ist, wenn man es mit der tatsächlich praktizierten Psychoanalyse in Austausch bringt, ein doch sehr hypothetisches Konzept. Sicherlich gilt dies mehr oder weniger auch für die Intensivberatung. S. Freud (1923) stellte das Dach der Psychoanalyse auf drei „Grundpfeiler“. Ein Psychoanalytiker akzeptiert demgemäß die Existenz unbewusster seelischer Vorgänge, nimmt die Lehre von Widerstand und von der Verdrängung an und stellt sich hinter die gegebene Einschätzung der Sexualität und des Ödipuskomplexes (229). Das sind die Strukturzüge der Neurosen. Die behandelbaren Störungen sind demgemäß verdrehte und unvollständige Lösungen und Konflikte infantiler Sexualität, insbesondere der Probleme und Konflikte des „Ödipuskomplexes“. Diese infantile Entstehungsgrundlage ist den Patienten nicht bewusst, die seelischen Zusammenhänge sind durch Abwehrformationen umgestellt. Die geschichtlich gebildeten Lösungsformen zwischen den Strebungen infantiler Sexualität einerseits und den Anforderungen des Erwachsenenalters andererseits wollen sich erhalten und setzen einer therapeutischen Veränderung einen schwer bewegbaren Widerstand entgegen. An dieser Stelle setzt die Behandlung ein. Es wird allgemein anerkannt, dass das wesentliche therapeutische Element der Psychoanalyse, ihr „wesentlichstes Stück der Heilungsarbeit“, die „Kenntnis und die Überwindung der Widerstände“ sei (225). Dabei wird als ein unschätzbares Hilfsmittel die Handhabung des Phänomens angesehen, dass die Fälle die bedeutsamen Muster ihres infantilen Seelenlebens auf den Analytiker übertragen. Diese „Übertragung“ wird als ein Medium verstanden, in dem die pathogene Konfliktkonstellation aktuelle Wirklichkeit erhält und damit erfahrbar, beschaubar und den verändernden Eingriffen zugänglich wird. Sie soll soweit wie möglich zum Verständnis und zur therapeutischen Beeinflussung des Falles ausgenutzt werden und muss gedeutet, das heißt dann auch aufgelöst werden, wenn sie zum Widerstand gegen eine verändernde Entwicklung wird. Neben der Deutung von Widerstand und Übertragung führt A. Freud (1965) noch zwei weitere „therapeutische Elemente“ der Analyse an, die allerdings auf einer anderen Ebene zu liegen scheinen. Demgemäß gehe es um eine „Erweiterung des Bewusstseins auf Kosten der unbewussten Anteile von Es, Ich und Über-Ich“, sowie um eine daraus „folgende Erweiterung der Ichherrschaft über andere Teile der Persönlichkeit“ (2339). Mit diesen Punkten sind wir aber schon bei den Behandlungszielen der Analyse angelangt. Bei Störungen, die vor allem auf psychischen Konflikten beruhen, gelten für A. Freud (1965) folgende Behandlungsziele der Analyse:
– Veränderung der wechselseitigen Beziehungen zwischen Es, Ich und Über-Ich
– Rückgängigmachen von Abwehrvorgängen, Erziehung des Ich zur Toleranz immer unentstellterer Abkömmlinge des Abgewehrten
– Herabsetzung der Intoleranz des Über-Ich
– intrapsychische Veränderung der Persönlichkeit
– Vertiefung der Einsicht und damit Befähigung für eigene Lösungen neurotischer Konflikte
– Herbeiführung dauernder Veränderungen in Ich, Es und Über-Ich (2327 f.)
- Freud hat sich stets skeptisch gegenüber den verändernden Wirkungen der Psychoanalyse geäußert. Die von ihr angegebenen Behandlungsziele weisen aber darauf hin, dass die angestrebten Umbildungen der Analyse andere sind als die der Intensivberatung. Letztere möchte im intensivierten Behandlungsgang ein Verrücken der Verhältnisse zwischen Bild und Gegenbild erreichen. Die Analyse dagegen will in der Behandlung weitgehende Veränderungen „in“ den psychischen Strukturen „begleiten“, die oft auch von dem Vorbild eines „reifen“ Funktionierens geleitet sind.
Übergangsverfassung
Wenn man die obige Darstellung der beiden Konzepte von Behandlung betrachtet, kann es erneut schwierig erscheinen, hier einen gemeinsamen Nenner für einen Vergleich der Methoden zu finden. Trotz des gemeinsamen Festhaltens an einer konsequent psychologischen Konzeptualisierung von Behandlung ist nicht zu übersehen, dass Analytiker, die Intensivberatungen durchführen, und solche, die Analysen machen, in ganz unterschiedlicher Weise klassifizieren und denken und letztlich auch ihre therapeutischen Maßnahmen anders einsetzen. Die Intensivberatung ist eindeutig keine „kurze Psychoanalyse“ und die Analyse ist keine langgestreckte Intensivberatung. Die Wirklichkeit, die es zu behandeln gilt, ist unterschiedlich aufgefasst — bei aller Gemeinsamkeit — und gerade bei der Aufgabe des Vergleichens von zwei Behandlungsformen wird erfahrbar, wie eng Theorie und Methode, Konzept und konkretes Vorgehen in der Behandlung miteinander verwoben sind. Trotzdem arbeiten beide im Rahmen der gleichen psychologischen Grundkonstruktion. Diese „Konstruktion psychologischer Behandlung“ (1980) hat W. Salber dezidiert dargelegt und von ihr aus die Intensivberatung als besondere Zentrierung von Behandlung beschrieben. Auch im Umkreis der Psychoanalyse bemühen sich einige Autoren darum, die allgemeine seelische Konstruktion der „Behandlung von der Seele aus“ zu erforschen. So hat M. R. Khan (1962) versucht, die Verfassung der analytischen Situation allgemein-psychologisch zu zergliedern. Khan, ein Schüler von Anna Freud und Donald Woods Winnicott, bezieht sich hierbei auf die Arbeiten von B. Lewin. Er stellt die psychischen Bedingungen, unter denen es zur Traumbildung kommt, denen gleich, die die besondere Verfassung der analytischen Behandlungsstunde strukturieren. Wenn die Psychoanalyse unter ähnlichen Konstruktionsverhältnissen stattfindet, die der Bildung eines „guten Traumes“ zugrunde liegen, kann sie eine Verfassung herstellen, die die Basis dafür ist, dass „Worte wirken“ können (s. a. Khan 1976). Diese Verfassung spitzt die Übergangsstruktur des Seelischen in besonderer Weise zu und macht sie damit als solche erfahrbar. Es werden Verhältnisse begünstigt, die es gestatten, die Ausdrucksbildungen in statu nascendi zu beobachten. Seelische Keimformen, die direkt in ein „Agieren“ übergehen, verdecken die Verhältnisse der Übergangsstruktur, und ihre Konstruktion kann daher nur beschränkt beschaubar gemacht werden. Weiterhin ist es im Rahmen dieser Verfassung möglich, dass mit wechselnden Auslegungen und Zentrierungen desselben Augenblicks experimentiert werden kann. (Bei Verhältnissen, die darauf angewiesen sind, dass sich eine Richtung gegenüber anderen verrückenden Zentrierungen starr durchhalten muss, ist solch ein Spiel wechselnder Zentrierung nicht möglich.) Auch sollte ein „haltender Rahmen“ bereitstehen, in dessen Spielraum sich auch ungeliebte Nebenbilder ausbreiten können. Eine wirksame Veränderung muss durch Wirklichkeiten hindurch, die beängstigend und verpönt sind. Unter bewertenden Verhältnissen wird sich kaum ein Fall auf dieses Abenteuer einlassen.
Intensivberater wie Psychoanalytiker halten sich daher an die Empfehlungen Freuds, sich ihren Fällen gegenüber „abstinent“ zu verhalten, sich ihnen weitgehend als „Spiegel“ zur Verfügung zu stellen. So soll sichergestellt werden, dass nicht reagiert, sondern beschrieben und analysiert wird. Hiermit hängt auch zusammen, dass sich in der Behandlung ein Umgangsmuster durchsetzt und erhält, das in seinem Kern methodisch geleitet ist und garantiert, dass das Bemühen um das gemeinsame Verständnis des Falles Vorrang hat. In der psychoanalytischen Literatur spricht man in diesem Zusammenhang von einem „Arbeitsbündnis“ (Greenson 1973). Nur wenn es gelingt, solche Verhältnisse herzustellen, lässt sich davon ausgehen, dass Analyse und Intensivberatung im Sinne einer therapeutischen Veränderung wirksam werden können. Bei Fällen („Entwicklungsstörungen“), die das nicht möglich machen, sollte die Intensivberatung passen. Es kann ihr nicht gelingen, innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit solche Voraussetzungen zu schaffen. Auch die klassische Analyse sollte sich hier auf ihre begrenzten Möglichkeiten besinnen (s. o. A. Freud 1979). Wenn sie bei solchen Fällen erfolgreich sein will, muss die Psychoanalyse ihr Dach auf einige weitere „Grundpfeiler“ stellen. Die Mittel der Deutung von Übertragung und Widerstand reichen hierzu nicht aus. Es müssen Tätigkeiten in Gang gesetzt werden, die in mühevoller Arbeit den Seelenzustand entwickeln, der für eine Behandlung durch Worte vorausgesetzt ist. Um mit Winnicott (1971) zu sprechen, ist es erforderlich, „den Patienten aus einem Zustand, in dem er nicht spielen kann, in einen Zustand zu bringen, in dem er zu spielen imstande ist“ (49, Hervorhebung vom Verfasser). Diese Überlegungen stellen die Grundlage für den Schluss dar, dass sich die Analyse (in ihrer klassischen Form) und die Intensivberatung den gleichen Indikationsbereich teilen. Fälle, die hierunter nicht fallen, sollten Analytikern zugewiesen werden, die mit solchen schwereren Störungen umgehen können. Eine in solchen Fällen versuchte Intensivberatung liefe leicht Gefahr, zu einem erfolglosen Behandlungsversuch zu werden, womit die Voraussetzungen des Falles, im Hinblick auf eine erfolgreiche Behandlung, in verschiedener Hinsicht verschlechtert werden können.
Intensivberatung: Kunstanaloge Modellierung
Die Intensivberatung hat bedeutend weniger Zeit zur Verfügung als die Analyse. Sie kann sich daher weniger ausführlich bei den Geschichten aufhalten, die der Fall in die Behandlung bringt. Während die lange Analyse dazu tendiert, wenn es therapeutisch zu rechtfertigen ist, zunächst einmal lange Zeit die Erzählungen des Falles zu beobachten und zu ordnen, legt es die Intensivberatung darauf an, möglichst schnell einen „Erzählstopp“ einzuleiten. Sie ist weniger durch eine Haltung von „Forschung“ reguliert und setzt ihre verrückenden Hebel sehr viel früher an. Ihr geht es dabei um ein gezieltes Aufbrechen konventioneller Formen der Wirklichkeitserfahrung, um ein baldiges methodisches Infragestellen der Geschichten und Erklärungen, mit denen die Patienten sich ihre Probleme fassbar zu machen suchen. Die Intensivberatung zieht einen Teil ihrer Wirkung daraus, dass sie die eingefahrenen Formen der Selbstbehandlung relativ schnell aufzustören sucht, sie gezielt ins Wanken bringt; sie möchte zum Staunen anregen und den Fall einer fruchtbaren Krise entgegenführen. Hiermit sind Wirkungsformen angesprochen, die auch aus den „Behandlungsformen“ der Kunst, insbesondere aber der modernen Kunst, bekannt sind. Ähnlich wie Kunstwerke verdeckte Verhältnisse der Wirklichkeit herauszurücken suchen und dabei ein Gestörtsein riskieren, legt es die Intensivberatung verstärkt darauf an, „Wirkungen, wie sie sich bei Kunstwerken finden, im Behandlungsprozess absichtsvoll in Gang“ zu bringen (W. Salber 1980, 146). Dementsprechend ist das Vorgehen der Intensivberatung viel eher als das der Analyse einer kunstanalogen Modellierung vergleichbar. Sie sucht eine Intensivierung der Behandlung zu erreichen, indem sie von vornherein psychästhetische Konstruktionszüge der Wirklichkeit akzentuiert. Einfälle und Geschichten werden zerdehnt, verdichtet und umgekehrt. Indem sie in Unterschiedlichem Analoges herausrückt, in Disparatem ein durchgängiges Problem, werden Betroffenheiten begünstigt, und es wird ein spielerischer Umgang mit den Ausdrucksformen des Seelischen angeregt. Indem das verkehrtgehaltene Werk in diesen Einflussbereich kunstanaloger Modellierung gerät, erhält es die Möglichkeit, sich für Augenblicke aus seinen festen, eingerasteten Verankerungen zu heben und sich gedehnteren, anders zentrierten Verfassungen zu überlassen. Die These ist, dass solch eine Zuspitzung kunstanaloger Behandlung der Wirklichkeit mit einer Veränderung festgehaltener Auslegung von Wirklichkeit einhergeht, dass die beschreibende Teilhabe an diesen psychästhetisch gefassten Momenten bereits „Veränderung“ ist. Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Erfahrung von Übergang zu. Bei Übergangserfahrungen handelt es sich z. B. um Momente, in denen die Taten und Leiden des Falles als von strukturellen Mustern getragen erfahren werden. Oder es geht um Augenblicke, in denen in dem erzählten Nacheinander einer Lebensgeschichte ein durchgehaltenes organisierendes Prinzip sichtbar wird. Verständlicherweise gehen solche Erfahrungen mit Betroffenheiten einher, sie bringen die Fälle häufig zum Staunen. Darüber hinaus kann es aber auch darum gehen, dass in der Behandlung festgehaltene Auslegungen der Verwandlungswirklichkeit in Übergang zu anders zentrierten Lebensformen und Verhaltensformen geraten. Zum Beispiel sucht ein Fall die Erfahrung zu vermeiden, dass gesicherte Formen des Halts und Habens übergehen in ein Entgleiten und Verlieren. Er verlagert einen großen Teil seiner Tätigkeiten darauf, die Entwicklungen der Beratung unter Kontrolle zu halten. Indem hier im Aktuellen die Angst vor dem Übergehen in Formen des Loslassens geklärt wird, ist es für ihn möglich, passager den gewohnten Halt aufzugeben, ohne dies durch kontrollierende Zugriffe abzusichern. Diese durchstandene Umwendung einer festgehaltenen Ausrichtung führt zu einer Entspannung. Die vorher als unüberwindbar geltenden Drehgrenzen verlieren ihre magische Wirkung. Die Bedeutung von Übergangserfahrungen für den Erfolg einer Analyse wird auch von psychoanalytischen Autoren betont. Winnicott sagt an einer Stelle, an der er sich über Kurzberatungen mit Kindern äußert, dass der entscheidend wirksame Moment nicht der sei, in dem eine „kluge Deutung“ gegeben wird, sondern „dass der entscheidende Augenblick der ist, in dem das Kind in Verwunderung gerät“ (Winnicott 1971, 63, Hervorhebung von W.). Auch A. Freud (1980) hat wohl solch eine Veränderung über die Begünstigung von bisher nicht verfügbaren kunstähnlichen Methoden der Wirklichkeitsbehandlung im Blick. Sie sagt nämlich, dass die „Einsicht“ in der Analyse im Wesentlichen eine „Neuerwerbung“ sei. Es kommt demnach der Analyse weniger darauf an, dass der Fall ein verlorengegangenes Wissen über seine Lebensgeschichte wiedererlangt. Die therapeutische Veränderung liegt vielmehr darin, dass er beweglichere Formen der Selbstbehandlung erhält. Diese neuen Erwerbungen schützen ihn vor einer nochmaligen „Erkrankung“. So sind also Züge von kunstanaloger Modellierung auch in der praktizierten Analyse beobachtbar. Vielleicht kann keine „Behandlung von der Seele aus“ auf sie verzichten. Und doch ist nicht zu übersehen, dass die Intensivberatung diesen Zug eigens thematisiert und methodisch einsetzt.
Analyse: Einübung in zirkuläre seelische Prozesse
Während die Intensivberatung die strukturelle Umbildung den nach 20 Behandlungsstunden erweiterten Selbstbehandlungsmethoden des Falles überlässt, vollzieht sich in der Analyse diese Umstrukturierung „unter den Augen“ des Analytikers während des Behandlungszeitraums. Die Analyse ist zu Ende, wenn Fall und Therapeut zu der Einschätzung gelangen, dass die Behandlung strukturelle Bedingungen geschaffen hat, die den Patienten von den Automatismen der Konfliktbewältigung unabhängig machen. Vorher hat der Fall bereits mehrere Male und in verschiedener Hinsicht gezeigt, dass er in Belastungssituationen nicht auf seine alten Beweismuster angewiesen ist. Der Weg zu diesem größeren Kreis an Gestaltungsmöglichkeiten vollzieht sich in der Analyse allmählich. Man kann auch davon sprechen, dass die Analyse ihre verändernde Wirkung daraus zieht, dass sie die Einübung in zirkuläre seelische Prozesse ermöglicht und begleitet. Diese langsame, aber therapeutisch wohl wirksamste Veränderung wird in der Psychoanalyse unter dem Begriff „Widerstandsanalyse“ beschrieben. Die Aufmerksamkeit des Analytikers ist hierbei im Wesentlichen auf Ausdrucks- und Umsatzprobleme zentriert. Es wird gefragt, welche Festlegungen der aktuellen Selbstbehandlung dazu führen, dass die „Grundregel“ (alles sagen, was sich im Erleben ereignet) nicht eingehalten werden kann. Greenson (1973) unterteilt den Vorgang der Analyse eines Widerstandes in mehrere Stufen. Zunächst kommt es darauf an, dass der Analytiker bemerkt, dass die Formenbildung sich auf einen engen Kreis konzentriert hat. Darauf ist der Fall mit diesem widerständigen Verhalten zu konfrontieren. In der Folge geht es darum, dieses Verhalten genau zu beschreiben und zu zergliedern, es mit Analogien auszutauschen und die Funktion desselben zu verstehen. Hierüber wird es dann möglich, die Abwehrformation im eigentlichen Sinne zu deuten, das heißt aus der Genese zu erklären. Wenn diese Analyse ausreichend gründlich vollzogen wird — und meistens reicht es nicht aus, die Reihenfolge nur einmal zu durchlaufen — kann der Fall in einer bestimmten Hinsicht etwas zum Ausdruck bringen, das ihm vorher nicht verfügbar war. In der Sprache der Psychoanalyse bedeutet dies eine „Ich-Erweiterung“ auf Kosten unbewusster Abwehrprozesse. Die zirkulären Gestaltungsformen haben eine Ausdehnung erfahren. Zur Einübung in zirkuläre seelische Prozesse gehört auch die Bereitstellung eines Gestaltungsrahmens, in dem sich Keimformen des Andersmachens arglos vollziehen können. Würde die Analyse sich darin erschöpfen, den Fall mit seinen Vermeidungen und Preisgaben zu konfrontieren, wäre unter Umständen nicht sichergestellt, dass dieser sich und seinem Analytiker vor Augen führt, was er nicht in Umsatz zu bringen wagte. Daher ist es wichtig, dass der Analytiker im gemeinsamen Werk der Behandlung einen erweiterten Verwandlungskreis vertritt und den Fall mit „wohlwollender Neutralität“ ermuntert, diesen zu betreten. J. Strachey, der sich 1935 mit den „Grundlagen der therapeutischen Wirkung der Psychoanalyse“ beschäftigt hat, gibt eine besonders klare Darstellung dieses Einübungsprozesses. Er spricht von einem „neurotischen circulus vitiosus“, an dessen Stelle in der Analyse ein „benigner Kreis errichtet“ wird (496). Mit der deutenden Bearbeitung wird in den engen Kreis von Selbstbehandlung „eine Bresche gelegt“, die gewissermaßen in den weiteren Kreis mündet (500). Von besonderer Bedeutung ist für Strachey hierbei, dass der Patient bei diesem Vorgang dazu neigt, „in der Analyse aus dem Analytiker ein ‚Hilfs-Über-Ich‘ (‚auxiliary super-ego‘) zu machen“ (496). Damit will er ausdrücken, dass der Fall in der analytischen Situation passager auf seine starren Drehgrenzen verzichtet und sich versuchsweise die erweiterten Regulationsnormen zu eigen macht, die mit der methodischen Haltung des Analytikers im gemeinsamen Werk gegeben sind. Indem es auf diese Weise immer wieder zu Eröffnungen eines größeren Verwandlungskreises kommt, an dem der Fall sich in einem geschützten Rahmen versuchen kann, kann er mehr und mehr auf die Wirksamkeit neuer Gestaltungsmöglichkeiten vertrauen, übt er sich ein in erweiterte Kreise der Zirkulation seelischen Geschehens. Deutungen, die hierzu beitragen, nennt Strachey „mutative Deutungen“. Sie sind „unvermeidlich von dem Prinzip der minimalsten Dosen beherrscht“ (501). Der „neurotische circulus vitiosus“ wird stets nur ein kleines Stück auf den erweiterten „benignen Kreis“ hin geöffnet. Auf diese Weise kommen die therapeutischen Veränderungen fast immer nur ganz allmählich zum Vorschein. Die erste Phase solch einer „mutativen Deutung“ ist in der Regel von Angst begleitet, denn sie bringt die Regulation des bestehenden Verkehrthaltewerkes ins Wanken. Die zweite Phase löst die Angst auf, denn sie bietet einen Formanhalt an, über den das Ganze wieder ein neues Gleichgewicht finden kann. Das Resultat sieht Strachey in einem um ein kleines Stück erweiterten circulus vitiosus, der die Basis bildet für eine nächste Erweiterung. Es liegt nahe, dass dieses Konzept von Veränderung in einer Kurzbehandlung kaum Anwendung finden kann. Es scheint dem Konzept einer kunstanalogen Steigerung und Modellierung der gelebten Wirklichkeit zur Erlangung eines wuchtvollen Perspektivwechsels konträr gegenüber zu stehen. Und doch gilt auch hier, dass wohl keine psychologische Behandlung ganz auf dieses Konzept einer schrittweisen Erweiterung enggehaltener Kreise von Selbstbehandlung verzichten kann. Wenn man so will, kann eine Intensivberatung im Ganzen unter diesem Aspekt betrachtet werden.
Intensivberatung: Zuspitzung der Bilderwirklichkeit
Die Formen seelischer Selbstbehandlung legen sich in anschaulichen Bildern aus und werden von strukturellen Bildern durchformt (W. Salber 1983). Wenn es der klinischen Behandlung gelingt, diese strukturellen Bilder beschaubar zu machen, ist damit eine Selbsterfahrung eingeleitet, zu der die Fälle von sich aus nie gelangen könnten. Mit dem Herausrücken einer bildhaften Konstruktion ist wohl die wuchtigste Umzentrierung gegeben, die gelebte Werke an sich zu erfahren vermögen. Denn hiermit werden Bilder, die bisher als das Ganze galten, zu Ausschnitten einer dunkel geahnten gelebten Figuration, die nun die Wirklichkeit aus einer bisher nicht verfügbaren Perspektive beleuchtet. Mit solchen Momenten arbeitet die „Behandlung von der Seele aus“, und die Intensivberatung betont diesen Gesichtspunkt in besonderer Weise. In der Intensivberatung wird von vornherein von Bildern her gedacht, vereinheitlicht und weitergefragt. Sie erfasst die seelische Formenbildung von ihrer erlebten Anschaulichkeit her und hebt deren Probleme in Bildern heraus. Demgemäß tendiert sie stärker als die lange Analyse dazu, Erzähltes und Beobachtetes typisierend in bildhafte Zusammenhänge zu rücken. Hierzu ein Beispiel: Ein Fall klagt darüber, dass es nie gelinge, zu einer dauerhaften Bindung an einen anderen Menschen zu kommen. Außerdem beobachte er bei sich eigenartige Zwänge, die ihn dazu treiben, sich immer wieder den Entscheidungen der Eltern zu unterwerfen. Daneben wird eine Fähigkeit sichtbar, in Bezug auf Partnerschaften immer „mehrere Feuer“ gleichzeitig zu schüren. Und, wie ein Grundton des Ganzen, scheint er eine konstante Angst zu verspüren, die alles in einen „dunklen Abgrund“ zu reißen droht. All diese disparaten Beobachtungen lassen sich miteinander verbinden, wenn man sie von einem einfachen Grundproblem von Selbstbehandlung unterlegt sieht. In diesem Fall geht es um das Problem des Übergangs von vielversprechenden Keimformen in entschiedene und damit ausschließende Sprossformen. Der Fall fürchtet die Festlegung, da sie für ihn zugleich Tod, Verlust von Lebendigkeit bedeutet. Das lässt sich material an einer Blüte veranschaulichen, die bemüht ist, die Pracht ihrer leuchtenden Farbigkeit zu erhalten, die den Übergang zum Verwelken aber vermeiden möchte, weil sie nicht darauf vertrauen kann, dass hieraus eine Frucht hervorgehen kann. Der Fall fürchtet die Verwandlung und sucht damit fertigzuwerden, indem er sie an andere delegiert oder deren Wirksamkeit auszugrenzen sucht. Er ist bemüht, ständig auf einer „hocherregten Stelle zu treten“ und zu vermeiden, dass er von fremden Anverwandlungen überrascht wird. Indem die Erzählungen und Beobachtungen mit solchen Typisierungen in Austausch gebracht werden, ist von vornherein die Bilderwirklichkeit des Seelischen angesprochen und eine intensivierende Veranschaulichung erreicht. Ein weiterer Aspekt der Zuspitzung der Bilderwirklichkeit in der Behandlung besteht darin, dass in der Intensivberatung „Märchenbilder“ herausmodelliert werden. Die Intensivberatung ist im Laufe ihrer Entwicklung zu der Einschätzung gekommen, dass Märchen sich besonders gut dafür eignen, den Konstruktionszusammenhang gelebter Selbstbehandlung zu veranschaulichen. Sie bringen in einer weiteren Hinsicht eine verrückende Wucht in den intensivierten Behandlungsgang. L. Salber (1984) führt die intensivierende Wirkung des Bezugs auf eine überschaubare Anzahl bereitliegender Märchenbilder auf die mit ihnen verbundene Akzentuierung bestimmter Dreh- und Angelpunkte zurück. „Märchen sind Wirkungs-Ganze, die den Entwicklungskreis einer Selbstbehandlungsgeschichte aufbrechen und fassbar machen. Sie zeigen eine Umstellungsmöglichkeit für die Behandlung des Gestalt-Verwandlungsproblems an, und zwar unter der Akzentuierung eines bestimmten Drehpunktes“ (29). Indem über die Modellierung des Märchenbildes die Drehgrenze des Falles eigens herausgestaltet und festgehalten wird, erhält die Intensivberatung, um die zehnte Stunde herum, nochmals eine gesteigerte Intensität. Diesen Übergang von der mehr typisierenden Bearbeitung des Behandlungsganzen (s. obiges Beispiel) zu der Wendung, in der über das Märchen alles auf einen bestimmten Punkt hin vereinheitlicht wird, beschreibt L. Salber folgendermaßen: „Im gemeinsamen Behandlungswerk zwischen Fall und Berater wird weiter eine Art seelischer Landschaft betrachtet, nun jedoch ‚kartiert‘ durch die Stellungen und Umstellungsmöglichkeiten des Märchens. Wir arbeiten also mit dem Märchen, weil es als Einheit die Vielfalt des Erzählten durch sein Gefüge bricht“ (29). Auch die Analyse bedient sich materialer Gebilde oder bildhafter Konstellationen, um die Behandlung zu typisieren. „Orales“, „Anales“, „Phallisches“, die Probleme des „Narzissmus“, die „Urszene“ und die Kernkonstellation des „Ödipuskomplexes“ verweisen darauf. Dies sind bildhafte Zusammenhänge, die strukturelle Schrägen durch „Erinnerungen“ und Erzählungen ziehen. Im Unterschied zur Intensivberatung stellt die Bildhaftigkeit des Seelischen in der Psychoanalyse allerdings nicht den Kern ihrer Wirklichkeitsauffassung dar und kann daher auch in deren Rahmen nicht in demselben methodischen Sinne eingesetzt werden wie in einer Behandlungsform morphologischer Herkunft.
Analyse: Zentrierung um den Analytiker
Die „Behandlung von der Seele aus“ strebt die Erfahrung der eigentümlichen Konstruktion an, die Erzählungen und Erlebnisse des Falles durchformt und seine spezifischen Festlegungen bedingt. Während die Intensivberatung diesen Punkt berücksichtigt, indem sie die Behandlung um ein bestimmtes Märchenbild zentriert, entgeht die Analyse einer Zerfaserung in unvermittelte Einzeltatbestände, indem sie die Gestaltungen des Falles um den Analytiker zu zentrieren sucht. Für die Dauer der Analyse werden Voraussetzungen geschaffen, die es ermöglichen, dass der Fall seine Gestaltungsprobleme „an dem Analytiker“ beleben, wiederholen und durcharbeiten kann: Der Therapeut in der Analyse bietet sich als ein „Übertragungsobjekt“ an. Diesen Vorgang beschreibt S. Freud (1914 a) folgendermaßen: „Die Übertragung schafft so ein Zwischenreich zwischen der Krankheit und dem Leben, durch welches sich der Übergang von der ersteren zum letzten vollzieht. Der neue Zustand … stellt eine artifizielle Krankheit dar, die überall unseren Eingriffen zugänglich ist. Er ist gleichzeitig ein Stück des realen Erlebens, aber durch besonders günstige Bedingungen ermöglicht und von der Natur eines Provisoriums“ (135). Mit der Übertragung ist ein Medium bereitgestellt, in dem die Probleme und Beweismuster des Falles aktuelle Wirklichkeit erhalten. Sie ist ein „Tummelplatz“, auf dem er „mit plastischer Deutlichkeit ein wichtiges Stück seiner Lebensgeschichte vorführt“ (S. Freud 1938, 101). An ihrem Leitfaden lässt sich aktualgenetisch verfolgen, welche Lösungen der Fall für seine Probleme durchzusetzen sucht. Im Verlauf der Behandlung neigen diese am Analytiker aktualisierten Selbstbehandlungsmuster dazu, immer einfachere und intensiver erlebte Formen anzunehmen. Die Übertragungen verdichten sich in der sogenannten „Übertragungsneurose“. Mit ihr steigert sich die zentrierende und einvernehmende Wucht der am Analytiker belebten Formenbildung. Es ist nun möglich, an den zentralen Verkehrungspunkten zu arbeiten, da sie als gegenwärtig erlebt werden. Von daher kann S. Freud sagen: „… was der Patient in den Formen der Übertragung erlebt hat, das vergisst er nicht wieder, das hat für ihn stärkere Überzeugungskraft als alles auf andere Art Erworbene“ (1938, 103). Schwierigkeiten bereitet diese Entwicklung dann, wenn ihre vermehrte Intensivierung die Formen des methodischen Vorgehens zerstört. Die um den Austausch zwischen Analytiker und Fall zentrierte Wirklichkeit kann nur so lange therapeutisch genutzt werden, wie die „Arbeitsbeziehung“ gleichzeitig wirksam bleibt. Ist die „therapeutische Ichspaltung“ nicht gegeben, geht die oben beschriebene Übergangsverfassung verloren und mit ihr auch die Voraussetzung für eine „Behandlung von der Seele aus“. Stone (1973) nennt dies den „spezifisch dialektischen Charakter und Stellenwert“ der Übertragungsneurose. Trotz ihrer Verkehrungsmöglichkeit ist der therapeutische Nutzen der „Handhabung der Übertragung“ nicht zu unterschätzen. Strachey (1935), der die mutative Wirkung der Übertragungsanalyse in besonderer Weise betont, sieht in der Neigung des Falles, all seine Regungen und Gestaltungsformen um den Analytiker zu zentralisieren, die psychologische Grundlage dafür, der Gefahr einer wilden, zerfasernden Deuterei zu entgehen. Die Handhabung der Übertragung schafft strukturelle Voraussetzungen für die Zentrierung der Behandlung um entscheidende Drehpunkte. Strachey: „Das Mittel, das Chaos zu verhindern, sowie, wenn es einmal eingetreten ist, das Heilmittel dagegen, besteht in der Rückkehr zu Übertragungsdeutungen nach Maßgabe der Dringlichkeit“ (531). „Denn die Welt der Erinnerung ist ein mächtiger Ozean“ (Stone 1973, 167). Um dieses Konzept psychotherapeutischer Veränderung zu veranschaulichen, folgendes Beispiel: Nach anfänglichem Aufflackern von Verführungsangeboten an den Analytiker richtet sich ein Fall für längere Zeit in dem Festhalten an einer Art ununterschiedener Gemeinsamkeit zwischen ihm und dem Therapeuten ein. Er legt dessen Äußerungen als „bejahendes Echo“ aus, schwelgt in dem Glück, mit dem Analytiker in allen Punkten einer Meinung zu sein. Eine Atmosphäre ungebrochenen, sofortigen Sich-Verstehens breitet sich aus. Indem der Fall diese Verhältnisse mehr und mehr zum Gegenstand seiner Beobachtung machen kann, muss er auch bemerken, dass solch eine Form idealisierter Gemeinsamkeit gar nicht durchzuhalten ist. Stück um Stück wird ihm deutlich, dass die Beiträge des Analytikers gar nicht Bestätigungen und Bejahungen sind, sondern oft sogar eine verrückende Perspektive in das gemeinsame Werk bringen. In dem Maße aber, in dem diese Übertragung aufgelöst wird, setzt sich eine andere durch. Mit der fortschreitenden Entidealisierung der Gemeinsamkeit wird sichtbar, dass diese die Funktion hatte, eine sich jetzt entfaltende Feindseligkeit dem Übertragungsobjekt gegenüber zu decken. In dem gemeinsamen Werk werden mehr und mehr Probleme zugespitzt, die mit der Durchformung unkultivierter Destruktion gegeben sind. Die Illusion ungetrübter Gemeinsamkeit wird abgelöst durch einen massiven Trotz gegenüber einem einengenden, bewertenden Übertragungsobjekt. Indem die daraus erwachsenden „Kämpfe“ aus der Entwicklungsgeschichte des Falles verständlich werden, lösen sie sich schließlich auf. Erst an dieser Stelle geraten wieder die anfänglichen Verführungsversuche in den Blick, die jetzt das Klima der Behandlung wesentlich bestimmen. Indem deren Konstruktion bearbeitet wird, gerät der Fall schließlich dazu in die Lage, Formen der Selbstbehandlung auszuprobieren, die das Leiden an den paradoxen Unlösbarkeiten der Wirklichkeit in Kauf nehmen. In der Intensivberatung sind solche Zentrierungen der Behandlung um den Analytiker zum einen in der gegebenen Zeit in der Regel nicht herstellbar. Zum anderen sind sie auch nicht erwünscht, weil damit eine starke Bindung entsteht, die womöglich in der kurzen Zeit nicht wieder aufzulösen ist. Die Momente, in denen deutlich wird, dass der Fall den Berater in die Logik seiner Beweisführung einbezieht, haben hier einen anderen Stellenwert. Während sie in der Analyse zum Zentrum der Behandlung werden, erhalten sie in der Intensivberatung eher die Funktion, das Märchenbild auch von der Seite der Übertragung her auszulegen und zu veranschaulichen. Übertragungserscheinungen in der Intensivberatung haben daher einen passageren Charakter, sie sind Material unter anderem und erhalten nicht den herausgehobenen Stellenwert, den sie in der Analyse haben.
Zusammenfassung
Intensivberatung und Psychoanalyse setzen beide eine spezifische Übergangsverfassung voraus, die die strukturelle Grundlage einer Behandlung durch Worte darstellt. In deren Rahmen bevorzugen sie jeweils unterschiedliche Konstruktionszüge psychologischer Behandlung. Die Intensivberatung sucht von vornherein Wirkungen zu begünstigen, die von der Analyse des Umgangs mit Kunstwerken bekannt sind – kunstanaloge Modellierung. Weiterhin spitzt sie die bildhafte Grundkonstitution seelischer Wirklichkeit zu und bemüht sich um eine fall-spezifische Zentrierung, indem sie in einem großen Teil der Behandlung Märchenbilder modelliert. Die Analyse dagegen betont mehr ein kontinuierliches Einüben in zirkuläre seelische Prozesse. Ihren besonderen Drehpunkt und damit auch ihre vereinheitlichende Wucht findet sie darin, dass sie die Formenbildungen des Falles um den minimalen Formanhalt des Analytikers zentriert.
Hinweis:
Dieser Artikel ist eine Neuauflage und wurde per Hand ins Digitale übertragen sowie an die neue Rechtschreibung angepasst. Wir bitten um Nachsicht für eventuelle Fehler.
Cremerius, J. (1982): Die Bedeutung des Dissidenten für die Psychoanalyse. Psyche 6.
Eissler, K. R. (1960): Variationen in der psychoanalytischen Technik. Psyche 10.
Freud, A. (1964): Wege und Irrwege der Kinderentwicklung. Die Schriften der Anna Freud, Bd. VIII, München 1980.
— (1979): Psychische Gesundheit und Krankheit als Folge innerer Harmonie und Disharmonie. Die Schriften der Anna Freud, Bd. X, München 1980.
— (1980): Über Einsicht in das unbewusste Seelenleben. Die Schriften der Anna Freud, Bd. X, München 1980.
Freud, S. (1905): Psychische Behandlung. GW V.
— (1914 a): Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten. GW X.
— (1914 b): Zur Einführung des Narzissmus. GW X.
— (1920): Jenseits des Lustprinzips. GW XIII.
— (1923): „Psychoanalyse“ und „Libidotheorie“. GW III.
— (1937): Die endliche und die unendliche Analyse. GW XVI.
— (1938 b): Abriss der Psychoanalyse. GW XVII.
Greenson, R. (1973): Technik und Praxis der Psychoanalyse. Stuttgart, 1981.
Khan, M. M. R. (1962): Die Psychologie der Traumvorgänge und die Entwicklung der psychoanalytischen Situation. In: Ders. (1977): Selbsterfahrung in der Therapie, München.
— (1976): Beyond the dreaming experience. In: Ders.: Hidden Selves – Between Theory and Practice in Psychoanalysis, London, 1983.
Salber, L. (1984): Märchen und Fallkonstruktion. In: Ahren/Wagner (Hg.), Analytische Intensivberatung, Köln.
Salber, W. (1977): Kunst, Psychologie, Behandlung. Bonn.
— (1980): Konstruktion psychologischer Behandlung. Bonn.
— (1983): Psychologie in Bildern. Bonn.
— (1984): Struktur in Entwicklung. In: Ahren/Wagner (Hg.), Analytische Intensivberatung, Köln.
Stone, L. (1973): Die psychoanalytische Situation. Frankfurt.
Strachey, J. (1935): Die Grundlagen der therapeutischen Wirkung der Psychoanalyse. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, Bd. XXI.
Winnicott, D. W. (1971): Vom Spiel zur Kreativität. Stuttgart, 1979.
Autor:in
Dr. Dirk Blothner
Psychologisches Institut II der Universität Köln
Arbeitsschwerpunkte: Psychoanalyse, Intensivberatung, Filmwirkung
Veröffentlichungen zu „Psychoanalyse und Intensivberatung“, „Psychologische Diagnostik in der Klinik“, „Der amerikanische Freund“, „Carmen“