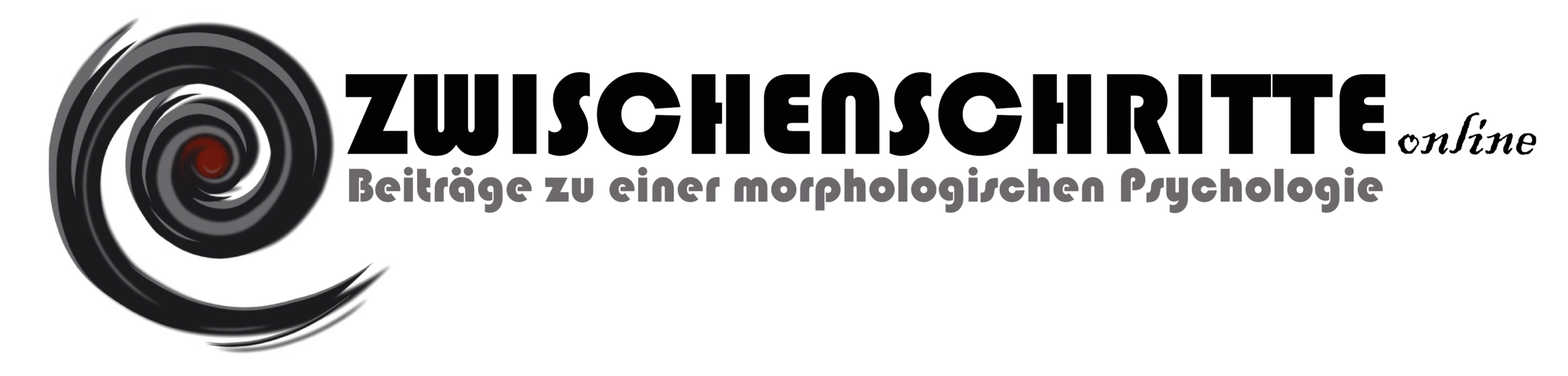Behandlung durch Worte: Konzepte rühren die Unterhaltung [Reprint]
Prof. Dr. Dirk Blothner (1996)
Autor:in
Dr. Dirk Blothner
Psychologisches Institut II der Universität Köln
Arbeitsschwerpunkte: Psychoanalyse, Intensivberatung, Filmwirkung
Veröffentlichungen zu „Psychoanalyse und Intensivberatung“, „Psychologische Diagnostik in der Klinik“, „Der amerikanische Freund“, „Carmen“
Behandlung durch Worte: Konzepte rühren die Unterhaltung
Menschen sprechen miteinander. Wir sind gewohnt, diesen Vorgang als einen Austausch von „Informationen“, als ein Mitteilen von Inhalten, zu verstehen. Doch das ist ein unvollständiges Bild. Wenn Menschen miteinander sprechen, suchen sie immer auch etwas zu bewirken. Sie wollen Anstöße geben, überzeugen. Sie suchen mit ihrer Rede Einfluss zu gewinnen. Reden ist Verführen, Einspinnen, Trennen und Vernichten. Sprechen ist immer auch Handeln. Es greift ein in den Lebensraum anderer Menschen. Wenn Menschen mit anderen sprechen, verfolgen sie damit Absichten – ob bewusst oder unbewusst.
Die psychologische Behandlung ist eine Form der Unterhaltung, die ihre Absichten explizit darstellt und diskutiert. Wissenschaftliche Psychotherapie beginnt dort, wo sich das Sprechen den Forderungen einer Methode unterstellt. wo es sich ausdrücklich im Austausch mit einem Konzept von Störung und Entwicklung bewegt. Der seelische Betrieb ist schon vor den Worten wirksam. Worte modellieren die Verhältnisse der seelischen Wirklichkeit, sie formen und nutzen sie aus. Je nachdem welches Bild die Psychologie vom Seelischen hat, wird die Wirkung der Worte verstanden.
Ich möchte am Beispiel der Freud’schen Arbeiten zur psychoanalytischen Behandlung und des Behandlungskonzeptes von Wilhelm Salber darstellen, welche unterschiedlichen Konzepte das Sprechen in der Psychotherapie leiten.
Richtungsverstärkung
Das erste Konzept, das Sigmund Freud (1890, 1892-93) entwickelte, mit dem er sozusagen anfing, war das der hypnotischen Suggestion. Wie findet das Sprechen im Rahmen dieses Konzeptes statt?
Da liegt eine Frau – ich habe mich für die weibliche Form entschieden, weil zu dieser Zeit die meisten Behandlungsgeschichten Freuds von Frauen erzählen – und scheint zu schlafen. Daneben sitzt ein Mann und redet auf sie ein. Wenn dieser davon ausgeht, dass sie seine Worte hört. kann sie allerdings nicht wirklich schlafen. Richtig: Es handelt es sich um einen Zustand, der dem Schlaf ähnlich ist. Die Patientin ist in Hypnose versetzt. Damit schränkt sich ihr Kontakt zur Welt auf die Worte des Hypnotiseurs ein. Sie wird alles, was er sagt, wie einen Befehl auffassen und auch ausführen. Der besondere Zustand, in dem sie sich befindet, erlaubt eine ungewöhnlich wirksame Einflussnahme auf ihre körperlichen Funktionen. So hören wir den Arzt immer wieder Worte sagen wie: „Sie werden stillen können. Sie werden reichlich Milch haben!“ Nachdem er seiner Patientin noch ein paar andere Anweisungen gegeben hat, weckt der Hypnotiseur sie auf. Die Patientin erhebt sich benommen, der Arzt verabschiedet sich. Die Patientin wird nun einige Zeit das ausführen, was der Therapeut ihr in der Hypnose aufgetragen hat – wenn es geklappt hat.
Die Szene wirkt befremdlich. Doch in dieser einseitigen Art, in der der Therapeut mit seiner Patientin spricht, steckt eine genaue Vorstellung über grundlegende Wirkungsverhältnisse im seelischen Geschehen. Freud ist der Auffassung, dass das Seelische mit der Aufgabe beschäftigt ist, eine Richtung in der Vielfalt durchzusetzen. Das Ich möchte seine Einheit erhalten, muss sich aber mit Gegenvorstellungen auseinandersetzen – mit peinlichen Erwartungen, Befürchtungen und Kontrastvorstellungen. Diese suchen es zu zerlegen und einzuschränken. Ein „gesundes Vorstellungsleben“ (1893-93, 9) kann sich über deren störenden Einfluss hinwegsetzen und an seinen Vorsätzen festhalten, sie schließlich doch ausführen. Das geschwächte Vorstellungsleben – und das wäre die hierzu gehörende Definition für Neurose – wird durch die Kontrastvorstellungen empfindlich eingeschränkt.
Indem Freud den geschwächten Vorsatz mit seinen Worten unterstützt, ihn gegen die Wirkung der einschränkenden Befürchtungen stärkt, unterstützt er die Tendenz zur Einheit, die beim Patienten geschwächt ist. Von diesem ersten Konzept Freud‘scher psychologischer Behandlung ausgesehen, besteht also die Hauptaufgabe des Sprechens durch den Arzt darin, die Einheit einer seelischen Formenbildung zu verstärken gegenüber dem, was ihr an Gegenläufigem widerfahren kann, was ihre Durchsetzungsmöglichkeiten schmälert. FREUDs eindringliches Sprechen intendiert eine Richtungsverstärkung von geschwächten Vorsätzen.
Wenn wir dieses Konzept der Rede Freuds unterlegen, wirkt die Darstellung der hypnotischen Behandlung nicht mehr komisch. Er hat die Patientin in einen Zustand versetzt, in dem er einen besonders starken Einfluss auf sie hat. Wenn er beharrlich auf sie einredet, so ist er darauf aus, ihre geschwächten Vorsätze auszurichten. Die Frau kam zu ihm, weil sie nicht stillen konnte. Sie konnte den Vorsatz nicht ausführen, obwohl sie es wollte. Freud redet ihr nun gut zu und sagt ihr, sie könne wohl stillen, ja, sie sei eine gute Mutter. Wenn sie aus der Hypnose aufwache, stünde ihr reichlich Milch zur Verfügung und sie werde zur Freude ihrer Familie ihr Kind gut nähren können. Er unterstützt die Vereinheitlichungstendenz der Patientin mit seiner Überzeugungskraft. Der Vorsatz zu stillen, der bislang durch Gegenvorstellungen unterbrochen wurde, kann daraufhin ausgeführt werden.
So greifen Konzept und Sprechen beim ersten Freud’schen Behandlungskonzept in einander. Nun fragt man sich, warum Freud nicht dabeigeblieben ist und warum wir das nicht heute noch so machen, wenn wir Psychotherapie betreiben. Zunächst: Die hypnotische Suggestion wird auch heute noch angewandt. Das ist deshalb möglich, weil dieses Konzept wirksame Verhältnisse des Seelischen berücksichtigt und ausnutzt. Die Tendenz seelischer Formenbildung, eine Richtung auszubilden und sie zu halten, kommt der hypnotischen Beeinflussung entgegen. Für Freud war das allerdings noch nicht genug. Mehrere wiederkehrende Schwierigkeiten brachten ihn dazu, das Seelische komplizierter zu sehen und sein Sprechen auf die Veränderungen seiner Theorie abzustimmen.
Komplettierung
Auch im Rahmen des zweiten Freud’schen Konzepts sehen wir den Therapeuten neben einer Liege. Wiederum liegt die Patientin auf dem Rücken. Aber der seelische Zustand, in dem sie sich befindet, ist anders. Sie ist wach. Noch etwas hat sich geändert: Der Therapeut spricht, aber die Patientin redet auch; im Ganzen sogar mehr als der Arzt. Genauer betrachtet spricht die Patientin meist mit Mühe. Sie versucht sich an etwas zu erinnern, etwas zusammenzustellen. Mal stockt ihre Rede, mal wird sie flüssiger. Um eine plastische Vorstellung zu erhalten, mag man sich Freud höchstpersönlich vorstellen, der neben seiner Patientin steht und ihr wiederholt auf die Stirn drückt. Dabei sagt er: „Sie wissen es! Sie wissen es! Reden Sie weiter, Sie müssen sich erinnern!“ Die Patientin windet sich, wehrt sich gegen die Aufforderung. Dann scheint ihr etwas einzufallen. Sie möchte es nicht mitteilen, doch Freud insistiert. Schließlich spricht sie weiter unter den Zeichen größter Beschämung. Allmählich wird ihr Ausdruck entspannter. Freud kann die Sitzung beenden. In dieser Szene bringt sich ein anderes Bild von der Wirkung der Worte zum Ausdruck. Freuds Aufmerksamkeit ist nicht auf die suggestive Stärkung eines gehemmten Vorsatzes in der Gegenwart gerichtet, sondern auf die Vergangenheit seiner Patientin. Er geht davon aus, dass es in ihrer Lebensgeschichte Situationen gab, in denen bestimmte, mit starker Bedeutung besetzte Handlungen nicht ausgeführt wurden. Von der Patientin verlangt er eine Komplettierung der einst unvollständig gebliebenen Handlungen im aktuellen Sprechen.
Diesem Konzept liegt die Vorstellung zugrunde, dass das Seelische Handlungsstrecken oder Handlungskreise zu durchlaufen hat Ein seelischer Akt hebt an mit einem Impuls, einer Spannung, und diese muss sich in Tätigkeit umsetzen. Wenn die Tätigkeit ausgeführt ist, ist der aufgekommene Spannungsbogen geschlossen. Damit ist der Anlass zur Handlung zu einem Ende, einer Lösung gekommen. Allerdings müssen sich die im Seelischen ablaufenden Handlungskreise mit überdauernden seelischen Kräften auseinandersetzen, die ihren Ablauf stören, unterbrechen und umleiten können. Bei manchen Handlungen muss mehr Aufwand betrieben werden, um sie durchzubringen, als bei anderen.
Die Neurose kommt zustande, wenn sich bedeutsame Handlungskreise nicht mit überdauernden Wirksamkeiten auseinandersetzen und stattdessen einen Ausweg ohne Aufwand einschlagen. Das Seelische greift auf kurzschlüssige Mechanismen zurück. Das befreit zunächst von Leiden, bringt aber empfindliche Einschränkungen mit sich. Die dennoch auf Weiterführung drängenden seelischen Regungen bringen sich anders zum Ausdruck. Sie finden eine Ersatzlösung z. B. in einer körperlichen Innervation, einem hysterischen Symptom. Die kurzsichtige Aufwandsersparnis wird mit einem körperlichen Leiden bezahlt.
Im Rahmen dieses neuen Konzepts sind es nicht mehr die stärkenden Worte des Therapeuten, sondern die einen unvollständigen Handlungskreis komplettierenden Worte der Patientin selbst, denen die therapeutische Wirkung zugesprochen wird. Das Reden des Therapeuten, sein Drücken und Insistieren dient dazu, den Strom der Einfälle und damit die nachträgliche Durchformung eines vergangenen Erlebnisses in Gang zu halten. Die einst unterbrochenen Handlungsansätze werden über die Vermittlung der Sprache nachträglich weitergeführt. Unter dem Druck des Therapeuten versetzt sich die Patientin in die Situation, in der es zum Einklemmen seelischer Regungen gekommen war, und sucht dem unentfalteten Handlungskeim nachträglich Form zu geben. Deshalb trägt dieses zweite Konzept den Namen „kathartische Methode“ (Freud 1890-1940, 55).
Bei der hypnotischen Suggestion war die Patientin noch ‚fein heraus‘. Denn von dem, was in der Behandlung passierte, merkte sie nichts. Das fand sozusagen im Schlaf statt. Es war noch nicht einmal ihre Leistung. Was jetzt hinzukommt, ist eine bewusste Auseinandersetzung mit den wesentlichen Wirksamkeiten der pathogenen Situation. Indem sie mit der oben beschriebenen Mühe verbalisiert, durchleidet sie diejenigen Konflikte, denen sie einst aus dem Wege gegangen war. Durch sein Insistieren und Drängen hält Freud sie bei diesem Erinnerungs- und Auseinandersetzungsprozess. Er sorgt dafür, dass sie sich dessen Mühen stellt. Er hält sie in der Lebenswirklichkeit, aus der er sie früher, als er seine Patienten noch in Hypnose versetzte, hätte entweichen lassen.
Rekonstruktion
lm Rahmen des dritten Freud‘schen Behandlungskonzeptes hat sich die Szene gewandelt. Da liegt einer auf der Couch, aber der Analytiker sitzt oder steht nicht mehr neben ihm, sondern hat hinter dem Patienten Platz genommen. Die Blicke der beiden an der Behandlung Beteiligten kreuzen sich auf diese Weise nicht Es sieht so aus, als seien sie mehr oder weniger mit sich beschäftigt. Es geht in der Regel ruhig zu. Der Patient redet, schweigt, redet wieder, stockt. Dann weint er, dann krümmt er sich, dann redet er wieder. Der Analytiker sitzt ruhig dahinter, sein Blick geht ins Weite, als sei er auf der Suche nach etwas. Gegenüber dem Leiden, den direkten Ansprachen seines Patienten zeigt er sich unberührt. Er ist zurückhaltender als beim kathartischen Verfahren. Der Mühen des Drängens und Drückens hat er sich entledigt. Ab und zu sagt auch er einmal etwas, doch das ist so, als werfe er einen Ball ins Spiel, ohne so richtig beteiligt zu sein; als interessiere es ihn eher, was der Patient aus diesem Anstoß machen wird. Auf diese Weise gehen die Jahre dahin. Ab und zu kommt es zu Krisen, die durch knappe Bemerkungen des Analytikers eine Auflösung erfahren.
Was für ein Konzept steckt in dieser Art, miteinander zu sprechen? Freud hat sich eine Vorstellung vom Ganzen des seelischen Lebensschicksals gebildet. Er sieht es als eine Metamorphose von einfachen Organisationsformen infantiler Sexualität, eine Wirkungsstruktur, in der sexuelle Muster in Konflikt geraten mit den Forderungen der Kultur. Freud ist der Auffassung, dass das frühe Seelenleben an bestimmten erogenen Zonen einen ersten Anhalt findet und damit Grundrichtungen der Behandlung von Wirklichkeit einübt. Das Seelische muss sich aus seiner wilden, polymorph-perversen Kinderstube emanzipieren und gesteuertere Formen entwickeln. Es muss seine einfachen Lebensformen in entwickeltere übersetzen. Allerdings gelingt ihm dies nicht ohne Reste. Die erwachsenen Menschen werden wieder eingeholt von den Mustern der Kindheit und geraten darüber in Konflikte. Denn das, was einst vertraut und lustvoll war, erscheint im Licht der Erwachsenenwelt hässlich und unangebracht. Die Konflikte werden in Abwehrmaßnahmen weitergeführt, die zu Einschränkungen, Hemmungen und Symptomen führen.
Freud hat so etwas wie ein entwickeltes, kultiviertes Gebäude vor Augen, das davon bedroht ist, von einfachen Formen infantiler Sexualität wieder eingeholt zu werden: ein komplizierter und von daher immer auch störungsanfälliger Zusammenhang, der einen mit Einschränkungen verbundenen Abwehrkampf zu führen hat. Die Aufgabe der Behandlung sieht Freud nicht mehr in der direkten Stärkung einer geschwächten Vereinheitlichung (Suggestion) und auch nicht in der Komplettierung von eingeklemmten Handlungsstrecken (Katharsis). Sein Tun und Sprechen, die Regeln, unter die er die psychoanalytische Behandlung stellt, zielen jetzt darauf, den unbewussten Zusammenhang zu rekonstruieren, der die kraftraubende Abwehr seiner Patienten motiviert.
Der Analytiker ist Forscher geworden. Er hat die Aufgabe, seine Patienten dazu zu bringen, das erforderliche Forschungsmaterial zu liefern und hat darauf zu achten, dass sich dieses allmählich zu einem bisher nicht verfügbaren Bild der Libido Entwicklung zusammensetzt. Psychoanalyse ist Rekonstruktion eines unbewusst gemachten seelischen Zusammenhangs.
Das gesamte Setting der Behandlung ist darauf ausgerichtet, dem Analytiker günstige Forschungsbedingungen zu schaffen und den Patienten dazu zu bringen, seine geheimsten Absichten zu verraten. Das Sprechen hat seine Direktheit (Bestärken, Aussprechen) verloren. Freud fordert seine Patienten auf, jede feste Zielvorstellung aufzugeben und das auszusprechen, was ihnen gerade durch den Kopf gehl. Sie sollen weniger erzählen als assoziieren. Er achtet auf das, was die Patienten unbeabsichtigt, gewissermaßen zwischen den Zeilen zum Ausdruck bringen. lm Blick des Analytikers entfaltet sich beim Patienten mehr und mehr so etwas wie eine zweite Rede. Andeutungen, Mitbewegtes und Indirektes treten in den Mittelpunkt des Bemerkens. Diese zweite Rede ist das Zentrum der Unterhaltung und weniger das, was der Fall mit seinen Worten bewusst zum Ausdruck bringt.
Im Wechsel von Sprechen und Schweigen – sowohl auf der Seite des Patienten als auch des Therapeuten – modelliert das Gespräch allmählich ein Bild von der Lebensgeschichte des Falles heraus, dass sich mehr und mehr, wie ein Wandgemälde durch den therapeutischen Raum erstreckt und von dem aus die Symptome des Patienten einen Sinn erhalten. Die Entwicklung dieses Bildes bestimmt, wann der Analytiker spricht, wann er mit seinen Worten eindringlich wird, wann er schweigt und wann er seine Beobachtungen und Vermutungen dem Patienten mitteilt. Die Zentrierung der Behandlung und das unbewusste ‚Gemälde‘ ist die Begründung dafür, dass Patient und Analytiker eigentümlich selbstversunken miteinander sprechen. Das unbewusste Bild lässt sich nicht direkt erforschen. Dafür sind kunstvolle Umwege erforderlich, die sich in doch etwas künstlich wirkenden Setting und Verhalten zum Ausdruck bringen.
Aktuelle Zuspitzung
Die Unterhaltung sieht zunächst nicht viel anders aus als beim dritten Konzept. Da liegt der Patient auf der Couch, redet, schweigt. Hinter ihm sitzt der Analytiker. Nur wenn wir genauer hinschauen, können wir bemerken, dass der Austausch zwischen Patient und Therapeut einen anderen Charakter hat. Der Analytiker ist nicht mehr ganz so zurückhaltend. Es ist, als habe er es aufgegeben, wie eine undurchdringliche ‚Spiegelplatte‘ zu wirken, wie Freud das einmal formulierte (Freud 1890-1940, 178). Er scheint beteiligter, er lässt sich stärker involvieren. Man kann beobachten, dass es zwischen den beiden sich Unterhaltenden schon mal hin- und hergeht, ja, Ansätze von Streit, ,Flirt‘, verspielte Bemerkungen lassen sich bei genauerer Betrachtung ausmachen. Dieses veränderte Verhalten, diese neue Art, miteinander zu sprechen, ist Ausdruck des vierten Konzepts, in dem Freud – besonders in seinen Spätschriften – das wirksame Zentrum der Psychoanalyse sieht
Freuds Psychologie hat sich inzwischen gewandelt. Er hat nicht mehr das breite ‚Wandgemälde‘, den langen Entwicklungsweg der Libido vor Augen. Er hat sich einem ähnlichen Begriff des Ganzen zugewandt wie zu Anfang seiner psychologischen Studien. Sein Sprechen wird geleitet von dem Konzept eines problematischen, ungeschlossenen Ganzen, das verschiedenen Anforderungen zugleich gerecht werden muss und dabei einen Kampf um seine Einheit führt. Das Ich hat im Seelischen die schwere und letztlich unlösbare Aufgabe, den widerstreitenden Forderungen der seelischen Grundtendenzen gerecht zu werden. Nur im Rahmen eines Entwicklungsprozesses kann es diese Aufgabe lösen. Das Seelische ist eine offene Konstruktion in Entwicklung (Salber 1973-74).
Das Ich suchte seine Entwicklungsarbeit mit unterschiedlichen Methoden zu leisten. Es kann den widersprüchlichen Anforderungen den Ganzen nachkommen, indem es sich verengt, einschränkt und sich in der Ausklammerung der Vielfalt auf eine einfache Lösung festlegt: Neurose. Es kann aber auch in weiteren Zirkulationen sein Glück suchen. Dann organisiert es sich in Verfassungen, die mehr zulassen, die Widerstreitendes nebeneinander bestehen lassen, die bewegliche Lösungen eröffnen. In diesen zirkulären Verfassungen hält es das Ich aus, dass die seelische Wirklichkeit grundsätzlich spannungsvoll ist und dass alle Lösungen einen Rest lassen.
Der Behandlung kommt die Aufgabe zu, die stillgelegte Zirkulation der Neurose durch geeignete Maßnahmen wieder in Entwicklung zu bringen. Das ist das neue Konzept, das nun das Sprechen von Analytiker und Patient leitet. Während es im dritten Konzept schwerpunktmäßig um die Rekonstruktion der Vergangenheit geht, setzen Freuds Eingriffe im vierten Konzept an den aktuellen Äußerungen des Ichs an. Es geht um eine Entwicklung des eingeschränkten Ichs im Hier und Jetzt. Es gebt weniger um Rekonstruktion als um Neu Konstruktion.
In Freuds Schriften findet dieses Konzept schon früh einen Ausdruck, wenn er von ‚Nacherziehung‘ (Freud 1890-1940, 118) spricht. Den Patienten soll weniger ein ihnen nicht verfügbares Wissen über ihr Leben vermittelt werden. Es geht darum, dass sie aktuell in zirkuläre Prozesse einbezogen werden, in denen ihre Einschränkungen und ihre Festlegungen eine Umbildung erfahren. Die Übertragung, die im dritten Behandlungskonzept ein Instrument ist, die Vergangenheit zu erforschen, sieht Freud jetzt als ein Medium an, über das allein der Fall dazu in die Lage gerät, auf eingeschliffene Muster zu verzichten. Die Übertragung wird als ein „Zwischenreich“ (Freud 1890-1940, 214), als ein „Tummelplatz“ (ebd.) und „Schlachtfeld“ (Freud 1917-18, 472) verstanden, wo sich alle Regungen, Konflikte und Entwicklungshoffnungen der behandelten Störung zeigen, auseinandersetzen und entwickeln können.
Die Übertragung wird zur »aktuellen Macht“ (Freud 1890-1940, 211), die dem Analytiker die Möglichkeit eröffnet, auf die Gestaltungen des Falles direkt Einfluss zu nehmen.
Daher ist das Sprechen zwischen Patient und Therapeut bewegter, wechselseitiger und alltagsnäher als beim dritten Konzept. Es hat zugleich einen mehr spielerischen und mehr realen Charakter. Das Konzept von Übertragung und Gegenübertragung wird verstanden als ein gemeinsames Werk, mit gemeinsam gehaltenen Festlegungen.
Der Unterschied in der Aufgabenteilung besteht darin, dass der Therapeut auf Grund seiner Kompetenz nicht so stark von diesem Werk einbezogen wird wie der Patient. Er agiert mitunter in dessen Sinne mit, ist aber dazu in der Lage, dieses Agieren zu bemerken und zu thematisieren. Das gemeinsame Agieren ist Gegenstand der Analyse. Indem Therapeut und Patient miteinander sprechen, behandeln sie aktuell wirksame Strukturen. Worte verrücken festgefahrene Drehgrenzen im Hier und Jetzt.
Ein beweglicher Austausch wird auf diese Weise etabliert, der mehr Möglichkeiten, mehr Spielraum aufweist, aber auch größere Gefahren in sich birgt. Denn wenn der Analytiker seine „neutrale“ Forscherhaltung preisgibt und sich auf einen „Tummelplatz“ begibt, ist selbstverständlich die Gefahr gegeben, dass das gemeinsame Werk entgleitet und beide in eine Richtung zieht, die sie nicht mehr steuern können.
Kunstanaloge Zuspitzung
Zum Abschluss möchte ich auf die Analytische Intensivbehandlung von Wilhelm Salber (1977, 1980) eingehen. Zunächst: Wie wird hier miteinander gesprochen? Die Couch bestimmt nach wie vor die Szene. Jedoch hat der Patient nicht den großzügigen Zeitrahmen der langen Psychoanalyse zur Verfügung, in dem er seine Geschichten und Gedanken ausbreiten kann. Die lntensivbehandlung ist eine Kurztherapie. Schneller als der Psychoanalytiker schaltet sich der lntensivbehandler ein. Er drängt zu genaueren Beschreibungen, treibt den Patienten zur Produktion von Einfällen an und hält ihn ab einer bestimmten Phase streng auf einer Linie.
Das Reden des Patienten erscheint in diesem Rahmen bewegter, stockender, dramatischer und weniger kontinuierlich. Er versucht der Beharrlichkeit des Therapeuten auszuweichen, rebelliert gegen ihn und lässt sich unter Umständen schließlich doch auf dessen Auffassung ein. Dass die Intensivbehandlung der Beeinflussung nähersteht als die Freud‘sche Psychoanalyse, zeigt sich schon in dieser Art der Unterhaltung.
Welches Konzept liegt dem zugrunde? Es ist das einer kunstanalogen Behandlung von Wirklichkeit. Die lntensivbehandlung ist eine Weiterführung des vierten Freud‘schen Behandlungskonzeptes unter den Vorzeichen einer psychästhetischen Auffassung von Wirklichkeit. Sie führt Freuds Konstruktionsanalyse einer problematischen Ganzheit als Bildanalyse weiter. Die Lebenswirklichkeit des Falles wird als ein Zusammenhang gesehen, der sich in Bildern zu behandeln sucht und sich als Bild überschaubar machen lässt. Ein Bild, das sich zugleich erhalten und verwandeln möchte, ist Gegenstand der lntensivbehandlung und leitet das Sprechen von Patient und Therapeut. Dies ist die Begründung dafür, dass sich die Intensivbehandlung als Strukturbehandlung versteht.
Wenn wir uns dieses Konzept in seinen Konsequenzen vor Augen führen, wird verständlich, warum das Sprechen bewegter, dramatischer ausfällt als in der Psychoanalyse. Die Worte dienen dazu, die Erzählungen der Patienten zu stoppen, aufzubrechen und zu zerdehnen. So wie die moderne Kunst mit ihren Methoden gewohnte Anschauungen in Krisen versetzt, so auch von Anfang an die Intensivbehandlung. Das kann nicht ohne Widerstand und Kampf gehen. Die Worte malen mehr als sie mitteilen. Sie heben aus den Erzählungen des Patienten einen unbewussten Bildzusammenhang heraus, indem sie diesen zuspitzen. Die Worte unterstreichen, extremisieren, karikieren und machen auf Schrägen und Analogien aufmerksam. Die Worte werden unter das Primat der Bildlogik des seelischen Geschehens gestellt. Dabei spielt die Zuspitzung der Züge, die im gemeinsamen Werk zum Ausdruck kommen, eine besondere Rolle.
Dies ist die morphologische Auslegung des Freud‘schen Übertragungskonzeptes: Alles, was der Patient im Behandlungswerk tut, was er sagt und nicht sagt, wird rot angestrichen und plakativ herausgestellt. Auf diese Weise heben sich Grundrichtungen heraus. Die psychologische Behandlung findet ihren Höhepunkt, wenn diese Skizzen einen Umbruch in Märchenbilder erfahren. Hiermit erhält der ganze Prozess eine Ausrichtung, die bis zur Beendigung der Behandlung nicht mehr preisgegeben wird (Blothner 1986).
Mit seiner Zentrierung auf die Behandlung des Ganzen und seiner Wendungen ‚in‘ der Übertragung ging Freud, wie oben erwähnt, die Gefahr der Verkehrung ein. Wenn sich der Therapeut zu sehr verwickeln lässt, kann er selbst zum Spielball derjenigen Mächte werden, die er in Gang setzte. Die lntensivbehandlung beugt diesen Gefahren durch Limitierung des Zeitrahmens (20 Stunden) und Zentrierung des Austauschs um ein Märchenbild vor. Nur in einem methodisch eingegrenzten Rahmen kann sie es sich leisten, die therapeutische Unterhaltung derart zu beleben und zu intensivieren (Blothner 1992).
Schluss
Es ist schon erstaunlich, welche Wege die psychologische Behandlung gehen musste, um schließlich wieder zu den anfänglichen Seherfahrungen zurückzukehren. Dabei handelte es sich nicht um überflüssige Umwege. Die verschiedenen Wendungen waren notwendig, um vorgestaltlich Gesehenes weiter zu explizieren. Als Freud seine ersten Behandlungen theoretisch zu fassen begann, hatte er ein Ganzes (Vorstellungsleben) im Blick, das mit Gegenläufen, Gegenwirkungen zurechtkommen muss. Über lange Zeit hat er diesen Ansatz aus dem Blick verloren und erst in seiner vierten Version wieder aufgegriffen – allerdings um wichtige Differenzierungen bereichert. Die morphologische Behandlung macht diesen ‚Rückgriff‘ mit und führt ihn zugleich weiter.
Bei der hypnotischen Suggestion lag der Patient im Schlaf, in Hypnose, und der Therapeut redete auf ihn ein. Wir verstehen, dass der Therapeut damit die geschwächte Richtung eines Ganzen zu stärken suchte. Hundert Jahre später haben wir wieder ein Ganzes im Blick. Aber wir suchen es nicht zu stärken, indem wir seine Schwäche durch das Unterlegen einer Richtung kompensieren. Vielmehr gehen wir – dasselbe Ziel im Auge – einen völlig anderen Weg: Wir stärken das Ganze, indem wir es ins Wanken bringen.
In einem kunstanalogen Prozess verrücken wir seine Festlegungen, zerlegen wir seine Selbstverständlichkeiten. Wir bringen es in eine Krise, spitzen seine Konflikte zu und lassen es einen revoltierenden Ruck erfahren. Das ist die Veränderung, die einhundert Jahre tiefenpsychologischer Behandlung erbracht haben.
Das Ich lässt sich nicht ‚stärken‘, indem wir auf nur eine Richtung setzen. In der psychologischen Behandlung haben wir es mit einer Konstruktion zu tun, die man paradoxerweise unterstützt, wenn man ihr Umbruche zumutet, die man stärkt, wenn man sie in Krisen führt, die man stabilisiert, wenn man sie ins Wackeln bringt. Das Seelische ist eine Verwandlungswirklichkeit, die dazu neigt, sich in bestimmten Verwandlungen festzusetzen. In der Psychotherapie geht es darum, diese Stilllegungen wieder in Zirkulation zu versetzen.
Menschen sitzen zusammen und reden. Ist das alles? Ich wollte zeigen, dass dies die unbedeutendste Seite des Ganzen ist. Sehr Unterschiedliches kann am Werk sein, wenn Menschen miteinander sprechen. Sprechen ist Handeln. Psychotherapie fällt nicht zusammen mit ‚Informationsaustausch‘ oder Überzeugung im Gespräch. In den Worten wirken Konzepte. Erst wenn man dies sichtbar macht, versteht man den sprachlichen Austausch zwischen Psychotherapeut und Patient.
Hinweis:
Dieser Artikel ist eine Neuauflage und wurde per Hand ins Digitale übertragen sowie an die neue Rechtschreibung angepasst. Wir bitten um Nachsicht für eventuelle Fehler.
Blothner, D. (1986): Intensivberatung und lange Psychoanalyse. Zwischenschritte (5)1
- (1992): Zum Umgang mit der Übertragung in langer und kurzer Analyse. Zwischenschritte (11)1
Freud, S. (1890-1940): Schriften zur Behandlungstechnik. Frankfurt/M 1975
- (1892-93): Ein Fall von hypnotischer Heilung, nebst Bemerkungen über die Entstehung hysterischer Symptome durch den „Gegenwillen“. Gesammelte Werke, Bd. 1. London 1940ff
- (1917-18): Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Gesammelte Werke. Bd. XI. London 1940ff
Salber, W. (1973-74): Entwicklungen der Psychologie Sigmund Freuds. 3 Bände, Bonn
- (1977): Kunst-Psychologie-Behandlung. Bonn
- (1980): Konstruktion psychologischer Behandlung. Bonn
Anmerkung
Nachdruck aus: Tüpker, R. (Hg) (1996): Konzeptentwicklung musiktherapeutischer Praxis und Forschung. Materialien zur Musiktherapie, Band l. LitVerlag, Münster/Hamburg/London
Autor:in
Dr. Dirk Blothner
Psychologisches Institut II der Universität Köln
Arbeitsschwerpunkte: Psychoanalyse, Intensivberatung, Filmwirkung
Veröffentlichungen zu „Psychoanalyse und Intensivberatung“, „Psychologische Diagnostik in der Klinik“, „Der amerikanische Freund“, „Carmen“