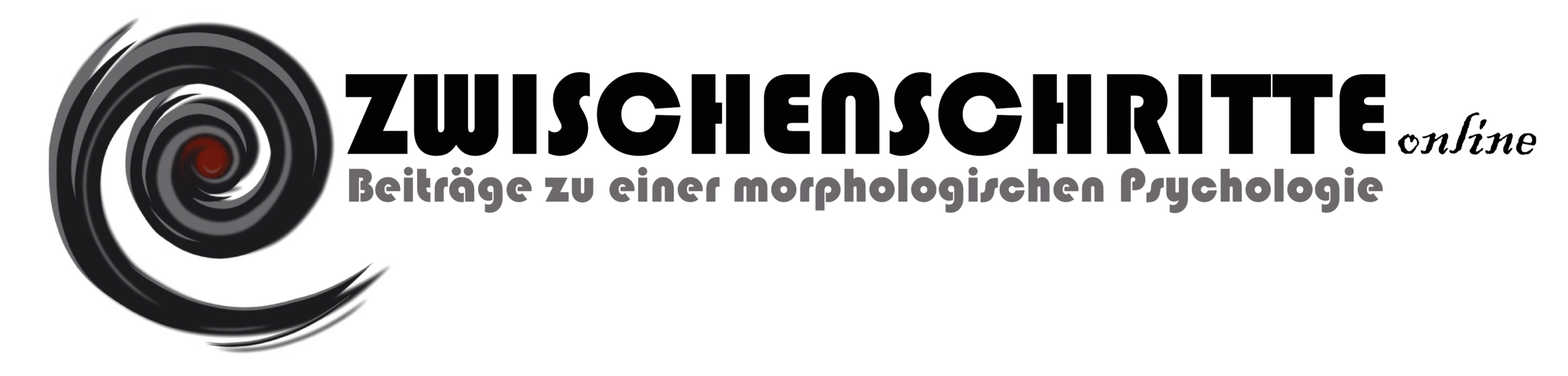Behandlung als Kulturbildung [Reprint]
Berufspolitische Überlegungen zur psychologischen Psychotherapie
Hermann-Josef Berk (1993)
Behandlung als Kulturbildung
Wir Psychologen in Deutschland befinden uns z. Zt. in einer interessanten berufspolitischen Situation. Alle politischen Parteien sind sich darüber einig, dass es ein Psychotherapeutengesetz geben muss. Die Frage scheint nur noch zu sein, wie viele und wie wenige Kontrollmechanismen bezüglich des therapeutischen Handelns in dieses Gesetz eingebaut werden sollen, damit auch sichergestellt sein könnte, dass der Begriff „Psychotherapie“ sich ausschließlich auf die Behandlung von Krankheiten bezieht. Das ist schon der Kontrast zu unserem Titel. In einem ersten Zugriff scheint dieses „Psychotherapie = Behandlung von Krankheiten“ keinerlei Probleme zu bereiten. Es ist klar und einsehbar, dass ein Unternehmen, das aus den Geldern der gesetzlichen Krankenkassen mitfinanziert werden soll, zur Behandlung von Krankheiten im Sinne der Reichsversicherungsordnung nicht z. B. der Teilfinanzierung einer beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung dienen darf. Zum Wächteramt des Staates gehört das Recht, eine Kontrolle über den Fluss gemeinschaftlicher Mittel zu haben; wenn diese Mittel […] sind zur Linderung und Behebung von Krankheiten, dürfen sie nicht für andere Zwecke verwendet werden. Solche volltönenden Sätze könnten wir noch stundenlang formulieren. Sie sind zweifellos richtig, sie tragen ihr Gewicht in sich selbst. Ihr Sinn erstreckt sich aber nur über alle Probleme staatlicher Zusicherungen und Kontrollierbarkeit dieser Zusicherung. Es geht nämlich immer nur um die gesetzlichen Krankenkassen und um sonst gar nichts. Ihr Sinn endet abrupt bei der Sache der Psychotherapie selbst. Ein kommendes Gesetz, seine Kommentierungen und Durchführungsbestimmungen werden uns nichts darüber lehren, was denn wesentlich beim Unternehmen „Psychotherapie“ ist; ein Gesetz wird nur etwas aussagen über Möglichkeiten und Grenzen ordnungsgemäßer Abwicklung psychotherapeutischer Praxis. Wollte man solch einem Gesetz etwas entnehmen über die Möglichkeiten und Grenzen psychischer Erkrankungen, wäre dies ein sinnloser Versuch. Das wird von vielen Kolleginnen und Kollegen oft verwechselt, die glauben, dass das Gesetz etwas über „Lehre“ sagt. Es scheint in dieser Form keinesfalls im Berufsfeld – besonders beim psychologischen Nachwuchs – klar zu sein: Hier gibt es ein beklommenes Lauschen darauf, welche Richtungen der Psychotherapie durch ein Gesetz wohl anerkannt werden. Entweder ist man dann mit dabei oder draußen. Es gibt jetzt bereits einen vorweggreifenden Run auf die Richtungen, die vermutlich dabei sind. Es wird nicht gesehen, dass der Gesetzgeber sich hüten wird, Richtungen anzuerkennen oder auszuschließen. Hier kommen nämlich ganz andere Dinge zum Einfluss. Aus den Bereichen Familienrecht und Kinder- und Jugendhilfegesetz ist bekannt, dass sie aus der Erkenntnis des Gesetzgebers heraus neu geschaffen wurden, dass Gesetze Rahmenbedingungen und rahmende Garantien geben können, dass sie aber keinerlei Einfluss auf die inneren Entscheidungssituationen der Individuen haben. Das war in der Gesetzesentwicklung ein wirklicher Schritt in einen vollkommen neuen Ansatz hinein. Dass sich nämlich der Staat da zurückgezogen hat. Im Familienrecht führte dies zur völligen Aufgabe des Schuldprinzips, im Kinder- und Jugendhilfegesetz führte es zur Forderung, auf die besondere Lebenslage fachlich einzugehen. Damit hier kein Missverständnis aufkommt: Das Gesetz mischt sich nicht in eine Lebenslage ein, sondern verlangt fachliche Leistung zur Hilfe in einer besonderen Lebenslage. Zur Hilfe. Der Staat hat sich also aus diesen Bereichen Familienrecht und Kindesrecht vollkommen zurückgezogen. Die Erkenntnisse dieser beiden Rechtsbereiche haben im Vorfeld der Diskussion zum Psychotherapeutengesetz erst ganz allmählich und zäh Raum gewonnen. Noch vor wenigen Jahren schien es so, als solle mit dem Psychotherapeutengesetz ein letztes Mal die Chance zum Eingriff in innere Entscheidungssituationen – diesmal einer ganzen Berufsgruppe – wahrgenommen werden. Zur Zeit sind aber hoffentlich alle Argumente der vergangenen Jahre, die in diesem Kontext verwendet wurden, erkannt worden als das, was sie sind – nämlich verräterische Vorurteile ihrer Absender. Hier nur ein Beispiel: Psychotherapie – das war also ein Argument der Medizinfunktionäre – dürfe eigentlich nur von Medizinern ausgeübt werden, da Psychologen nicht in der Lage seien, körperliche Erkrankungen zu erkennen, so dass die Gefahr bestünde, dass Psychologen diese entweder übersähen oder deren Symptome als neurotische Symptome fehlbehandelten. Dieses Argument ist mittlerweile durch eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen aus der Welt geschafft, aber wir haben dieses Argument herausgegriffen, weil seine Geschichte eigentlich ein eigenes Buch verlangt. Das Design dieses Scheinarguments wurde nämlich bereits in den 20er Jahren in Österreich entworfen, bereits damals als Versuch, die Psychoanalyse für Ärzte zu monopolisieren, nachdem sie durch Ärzte nicht vernichtet werden konnte. Diese Situation haben wir seit Beginn der Diskussion um das Psychotherapeutengesetz exakt noch einmal erlebt. Damals ging Freud in seinem Aufsatz „Die Frage der Laienanalyse“ darauf ein, indem er feststellte, dass der Arzt in der medizinischen Schule eine Ausbildung erfahren hat, die ungefähr das Gegenteil von dem ist, was er als Vorbereitung zur Psychoanalyse brauchen würde: „In der praktischen Heilkunde der Medizin ist der Neurotiker eine unerwünschte Komplikation. Eine Verlegenheit und für seine Würdigung wie für seine Behandlung leistet die medizinische Schulung nichts, aber auch gar nichts“, weil sie sich strukturell ganz anders spezialisieren muss. Das ist nämlich letztlich kein Vorwurf. Damals musste Freud sehr aufwendig argumentieren, um zeigen zu können, dass Organbehandlung und Seelenbehandlung zwei strukturell verschiedene Spezialisierungen sind, die völlig verschiedene klinische Blickrichtungen als voraussetzende Bedingungen haben. Wir können es uns heute scheinbar einfacher machen, indem wir stumm das Untersuchungsergebnis vorweisen, dass bei einer zu großen Gruppe psychisch Erkrankter der Einleitung einer regulären Psychotherapie fünf bis acht Jahre medizinischer Fehlbehandlung vorausgegangen sind. Diese Zahl ist in Forschungsgutachten des Bundesministeriums festgehalten. Wir werden aber sofort aus der Stummheit gerissen, weil einen wahren Medizinfunktionär Tatsachen in keiner Weise davon abschrecken, dass das Übersehen und Verkennen organischer Prozesse nachweislich in der Praxis der Psychotherapie keine Rolle spielt; dass die Behauptung, die Medizin würde ganzheitlich behandeln, in der Praxis der Medizin in einem überhaupt bemerkenswerten Maß nicht vorkommt – aus zeitlich-ökonomischen Gründen für den medizinischen Praktiker sogar ruinös wäre. Ein niedergelassener Mediziner muss etwa 300 DM pro Stunde umsetzen, er kriegt aber, wenn er sich psychotherapeutisch einlässt, nur etwa 100 bis – wenn er hart ist – 200 DM; d. h. er würde pro Stunde 100–200 DM dazusetzen, da muss er schon sehr gut geerbt haben, um das durchzuhalten. Ein solches Vorgehen wäre also in der medizinischen Praxis ruinös. Dass Organmedizin und Psychotherapie strukturell völlig anders spezialisierte Ansätze benötigen – all dies greift nicht, löst in medizin-politischen Kreisen mehr beunruhigte Kampfbereitschaft als Bereitschaft zur Problemlösung aus. Während in der öffentlichen Diskussion die Argumente gegen eine selbständige psychologische Psychotherapie wie Schilf wegbrechen – also man siegt sich kaputt: Man kann hingehen, wo man will, man kriegt immer Recht –, arbeiten im zuständigen Ministerium die Zuständigen hart an einem Gesetzentwurf, der psychologische Psychotherapie doch noch irgendwie als Abart der Medizin erscheinen lassen soll, um so eine Rechtfertigung zu konstruieren, die der Medizin doch noch ein Erstinterventionsrecht sichert. D. h. erst zum Arzt, dann: „put your body on the couch“. Wir kommen aus dieser Trickfalle nur heraus, wenn wir uns verschiedene Voraussetzungen verdeutlichen. Wenn im medizinpolitischen Kontext von „Medizin“ die Rede ist, dann ist nicht von ihrer Praxis die Rede, sondern von ihrem theoretischen Ideal. Wenn also getönt wird, Medizin behandle ganzheitlich – nicht die armen Patienten, das ist einfach nicht so, aber das Ideal ist, dass sie es tun würden. Weiterhin – das ist für Laien oft unbekannt – ist nicht von der Medizin als Heilkunde im engeren Sinn die Rede, sondern verdeckt von der Medizin in ihren erweiterten Funktionen, beispielsweise von ihren polizeilichen Funktionen: Die Medizin hat z. B. Ordnungsfunktionen, sie greift bei Seuchenprozessen ein, sie greift bei Zwangseinweisungen ein. Es wird von Laien oft gar nicht gesehen, dass die Medizin folglich Funktionen hat, die mit Medizin als Heilinstrument gar nichts mehr zu tun haben – die greifen dann aber ein. Weiterhin wird Psychotherapie daraufhin beobachtet, ob ihr durch ein Gesetz die von der Medizin bekannten Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet würden. Das ist in verschiedenen Diskussionen sehr verräterisch gewesen, z. B. bei Diskussionen mit Politikern: Die fragten: „Wie machen Sie das denn mit Überweisungen?“ Und wir sagen: „Wie, welche Überweisungen?“ Den Politikern war nicht klar, dass, wenn Patienten zu uns kommen, wir dann in Supervision gehen; d. h. wir „überweisen“ uns selber an Kollegen, kommen dann zurück und reden weiter. Die Politiker hatten Angst, wir würden die Patienten im Kreis überweisen, also da sind fünf Couches, und wir schicken die alle über die Couches und rechnen ab. Die zweite Vorstellung war: Wie machen Sie das denn mit der Testdiagnostik? Auf die Idee bin ich nun wirklich nicht gekommen. Die hatten Angst, wir würden die Klienten vor jeder Stunde testen und das dann abrechnen. Das ist jedoch verräterisch, denn Mediziner – die können das machen, die können ihren Patienten einen Zettel in die Tasche stecken und sie rundschicken. Die können, wenn Sie in deren Praxis kommen, nochmals röntgen und – zack – da haben die Mediziner schon wieder ein Bild von Ihrem Skelett an der Wand hängen. Das können wir gar nicht in dieser Form. Also, man lernt dazu.
Jetzt wird es etwas gefährlicher. Wenn von Psychotherapie die Rede ist, dann von der axiomatischen Behauptung der Medizinfunktionäre, sie sei Teil der Medizin – da diskutieren die gar nicht drüber. Man kann also argumentieren, wie man will, das hilft nichts. Der fachliche Umgang mit Psychotherapie – und da wird es gefährlich – soll dann auch den fachlichen Regeln der Organmedizin angepasst werden. Gerade hat eine Gebietsreform stattgefunden – es gibt also jetzt den Facharzt für Psychotherapie und den Facharzt für Psychosomatik. Prima. Aber andere Vorstellungen waren, wir hätten unsere berufliche Struktur so zu gliedern, dass wir der Therapeut für Einzelbehandlung wären; wer das macht, muss dann eine Bescheinigung erwerben. Wenn man etwas anderes machen will – z. B. Gruppen oder Kinder –, muss man dafür wieder eine Bescheinigung erwerben. Das wäre jedes Mal ein gesonderter Prüfungsgang gewesen. D. h. im schlimmsten Fall hätte einer von morgens bis abends in seiner Praxis gesessen und Einzelfälle behandelt; da wäre es gut, dass es dann Psychiatrien gibt. Im schlimmsten Fall hätte einer von morgens bis abends in seiner Praxis gesessen und Gruppen gemacht; im schlimmsten Fall hätte einer in seiner Praxis gesessen und von morgens bis abends Kinderbehandlungen gemacht. Dann bräuchten wir für diese Kolleginnen und Kollegen eigene Kliniken. Zur Verwirrung in den Voraussetzungen tragen erstklassige Psychotherapeuten bei, die von Hause aus Mediziner sind. Die werden als Trumpfkarten in der medizinpolitischen Argumentation benutzt und merken dies selbst oft gar nicht. Diese Liste ist nicht vollständig, sie reicht aber für unsere Zwecke aus; sie zeigt nämlich, dass alle Voraussetzungen und Argumente nicht an der Wirklichkeit der psychologischen Psychotherapie orientiert sind, sondern an fixen medizinpolitischen Vorstellungen, die präventiven Charakter haben. Da habe ich auch eine Zeitlang gebraucht, das zu kapieren: Die sprechen gar nicht darüber, was wir tun, sondern was wir aus fixen Ideen heraus tun könnten. Egal, ob wir das kennen oder nicht, das wird mit eingedacht, mit in diese Regelungen reingenommen. Jetzt habe ich mir mal vorgestellt, was ist das denn, um was es da eigentlich geht, und ich möchte versuchen, Ihnen jetzt einmal dieses Klima zu beschreiben. Man könnte die klimatischen Bedingungen für diese fixen Vorstellungen etwa so beschreiben: „Was passiert, wenn wir diese möglicherweise außerordentlich gefährliche, möglicherweise unberechenbare, als Lipizzaner völlig untaugliche Milchkuh an die Kette der gesetzlichen Krankenversicherungen legen. Um allen Eventualitäten vorzubeugen, denken wir uns Spielregeln aus, die auch ein lebensfrohes Raubtier mit Sicherheit in die Depression jagen.“ Demnächst wird der Entwurf zum Psychotherapeutengesetz kommen. Wenn Sie den Satz dann mal da dran halten, dann werden Sie das wiedererkennen, was mit diesem Klima gemeint ist. Das sieht dann genauso aus. An diesem Klima arbeiten nun die Fachleute. Und wenn Fachleute arbeiten, hat das auch ein Ergebnis. Ein solches Ergebnis ist zum Beispiel die Definition von Psychotherapie durch Strotzka 1975 in seinem Buch „Was ist Psychotherapie?“ – jetzt muss ich etwas Luft holen – die ist nämlich lang:
„Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsensus möglichst zwischen Patient, Therapeut und Bezugsgruppe für behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln durch Kommunikation meist verbal, aber auch averbal in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel – Symptom-Minimalisierung und/oder Strukturänderung der Persönlichkeit – mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens. In der Regel ist dazu eine tragfähige emotionale Bindung notwendig.“ Diese Definition ist genial. Ihr Vorteil liegt nämlich darin, dass sie in ihrem Gesamtverlauf und in allen ihren Untergliederungen quälend langweilig ist. Sie legt nahe, dass Psychotherapie eine Art „Strafe“ sei und somit den Regeln politischer oder gewerkschaftlicher Verhandlungsführung nahe kommt – das kennen Politiker. So erschien sie auch tauglich, im Forschungsgutachten zu Fragen eines Psychotherapeutengesetzes im Auftrag des zuständigen Bundesministeriums die Ordnungsmacht zu übernehmen. Dieses Gutachten stützte sich auf diese Definition – da fühlen Politiker sich drin zu Hause. Diese Definition suggeriert, dass einer schon sehr in Not sein muss, um sich solch einem Unternehmen zu überlassen. Diese Definition schaltet jeden Sozialneid aus. Denn eine hohe Politikerin versicherte in einem Fernsehinterview, dass ein Psychotherapeutengesetz sicherstellen müsse, dass keiner zu seiner Unterhaltung in eine Psychotherapie gehe und dies dann über die Kasse abrechne. Richtig, möchte man rufen! Bis einen von innen her die Frage beschleicht, welcher meiner Patienten war denn zu seiner Unterhaltung bei mir in psychotherapeutischer Behandlung?! Fieberhafte Durchsicht der Patientenkartei führt zu dem Ergebnis: keiner. Alle kamen mit einer gravierenden Problemstellung. Aber jetzt kommt das Problem: Alle haben sich mit mir besprochen und – jetzt muss ich es gestehen – es war für beide Seiten nicht langweilig. Haben wir dann etwas Gesetzeswidriges getan? Es ist offenbar kaum erträglich, dass psychologische Psychotherapie sich nicht der Choreographie der Medizin bedient. Wenn Sie die GOÄ mal lesen, da sind die Bewegungen der Mediziner in Ziffern aufgeteilt, und dahinter steht jeweils DM 4,20, DM 9,17 – ein Mediziner bewegt sich so. Wir passen in diese Choreographie nicht rein, sollen aber da reingepasst werden, also wie ich das eben beschrieben habe mit Einzeltherapeut, Gruppentherapeut, Kindertherapeut, dann wären wir ja in einer merkwürdigen Bewegung drin. Es ist offenbar unerträglich, dass keiner weiß, was sich hinter den Türen der psychotherapeutischen Praxen abspielt, wenn er selbst nicht an einer solchen Kur teilgenommen hat. Vor diesen Problemen stand auch bereits Freud. Psychotherapie lässt sich nämlich tatsächlich nur eine Strecke weit erklären, danach ist sie in ihrem Wesen nur mittels eigener Erfahrung zu begreifen. Aber ganz so aussichtslos ist die Sache nicht, wenn man sich unsere, die anderen Voraussetzungen einmal deutlich macht, unter welchen psychologische Therapie zustande kommt. Das medizinische Denken ist darauf ausgerichtet, etwas „wegzumachen“. In der psychologischen Therapie muss aber zunächst in der gemeinsamen Arbeit Patient/Therapeut vieles „dazugetan“ werden, ehe sich etwas auflöst. Auf diese Voraussetzungen würde man allerdings nie stoßen, wollte man etwa verstehen durch Lektüre z. B. des Diagnosenschlüssels und Glossars psychiatrischer Krankheiten. Das ist dieses Ding hier, da stehen alle Krankheiten drin. Bereits das Inhaltsverzeichnis liest sich wie eine ehrwürdige Versammlung. Es fängt nämlich an: Organische Psychosen, das ist der Diagnosenschlüssel 290.0 bis 294.9. Der Auftakt 290.0 ist die einfache, senile Demenz, so geht das los, ganz unsensationell, ein befriedetes Bild. Dann geht es weiter: Andere Psychosen 295.0 bis 299.9. Hier werden bereits sehr viel mehr Nummern aufgeführt, der Auftakt 295.0 ist die Schizophrenia simplex, auch hier geht es in der Beschreibung so friedlich zu, dass man sich fast überlegt, ob eine Schizophrenia simplex nicht eher eine Art erstrebenswerter Zustand ist. Es heißt nämlich: Eine Psychose, bei der sich Absonderlichkeiten im Verhalten, Unfähigkeiten, den Anforderungen der Gesellschaft zu entsprechen, und Leistungsabfall auf allen Gebieten schleichend entwickelt. Wer kennt das nicht? Man denke nur an seinen Zustand auf der letzten Gesellschaft, bei der auch unter Anwendung von Gewalt kein Interesse aufkommen wollte. Es geht weiter mit Neurosen – da horchen wir auf – Persönlichkeitsstörungen (Psychopathien) und andere nichtpsychotische psychische Störungen. 300.0 bis 316. Hierbei ist 300.0 die Angstneurose, die kennen wir ja. Jetzt heißt es aber: Verschiedene Kombinationen körperlicher und psychischer Angstsymptome, die keiner realen Gefahr zuzuschreiben sind. Das kennen wir vom Lampenfieber her. So friedlich geht es zu, und schließlich gibt es noch die Oligophrenien, 317 bis 319. 317 ist der leichte Schwachsinn und 319 der nicht näher bezeichnete Schwachsinn. Ehe wir in Versuchung geraten, den Diagnosenschlüssel der Nummer 317 oder 319 zuzuordnen, hält uns ein anderes Phänomen gebannt. Wie sind die Neurosen in diese psychiatrische Speisekarte gelangt? Das muss ich Ihnen jetzt einmal erklären.
Da gibt es einen Kurt Schneider. Und da gibt es einen Gerd Huber. Vor Kurt Schneider gab es hier in Köln eine blühende Psychiatrie. Das war mit der Nazizeit abrupt zu Ende. Dann hatten wir unseren Kurt Schneider, der endlich „Ordnung“ in die Psychiatrie reingebracht hat, indem er unterschieden hat zwischen den Psychosen und den Psychopathien. Schneider stand einfach vor dem Problem: Was ist eigentlich die echte Klientel der Psychiatrie? Das waren die Psychosen, das hat er ja auch alles aufgeführt. Und was ist eigentlich für die psychiatrische Klinik der „Schrott“? Das sind die Psychopathien, da können wir als Psychiater – fein, wie wir sind – eigentlich gar nichts mit anfangen. Entsprechend lesen sich dann auch diese Bezeichnungen der Psychopathien. Kein Wort von Neurose. Nichts. Weit und breit. Was ich hier habe, das ist eine Ausgabe – mal sehen – 9. Auflage 1970. Da war die Psychoanalyse 75 Jahre alt – kein Wort davon! Gab es für Schneider nicht.
Aber ein Schneider-Schüler, Gerd Huber, hat sie auf einmal, die Neurose, und zwar liest man dann in dieser Auflistung hier: System der klinischen Psychiatrie, multifunktionale Betrachtung. Toll, nicht? Da findet man dann auf einmal „Angeborener Schwachsinn, Psychopathien, abnorme Erlebnisreaktionen, einschließlich Neurosen“. Man würde ja denken, da ist in der Psychiatrie was passiert, denn der Neurosenbegriff, da weiß man ja irgendwie, wo der herkommt. Man muss dann aber feststellen, dass im Literaturverzeichnis bei Huber der Name „Freud“ nicht auftaucht. Dieser Vorgang der Okkupation, dass die Medizinpsychiatrie in einen anderen Bereich reingeht und ganze Lehrgebäude okkupiert – ich sage: raubt! – häuft sich. Wenn ich hier etwas über die Medizin herfalle, dann muss ich Ihnen jetzt sagen, ich treffe eine sehr strikte Unterscheidung, und zwar: Ich meine dann nicht die Mediziner, mit denen ich befreundet bin, sondern Medizin meint Medizinpolitiker, zum Teil weder Mediziner noch Psychologen, die aber ganz andere Interessen verfolgen – auf dem Rücken der laufenden berufspolitischen Probleme. Wenn also das Wort „Medizin“ fällt, dann meine ich immer „die“. Und „die“ verprügle ich auch nach Herzenslust, es sind also nie die Kolleginnen und Kollegen gemeint, die zum Teil als exzellente Psychotherapeuten, Psychoanalytiker der verschiedensten Richtungen und Schulen tätig sind, die – das wird Ihnen aber jetzt auch klar sein – von den Medizinpolitikern missbraucht werden als Aushängeschild. Da sind dann erstklassige Leute, von denen dann gesagt wird: Ja, und das sind die Mediziner! Die decken aber ein riesiges Feld ab, von „Medizinern mit Zusatztitel“, deren Denken und Handeln hat mit Psychotherapie nur sehr begrenzt etwas zu tun. Der letzte Coup war, dass die ganze Verhaltenstherapie, von der wir dachten, das wäre nun eine genuin psychologische Entwicklung, mittlerweile von der Medizin kassiert worden ist. Diesen Vorgang müssen wir uns vor Augen halten. Es bedeutet nämlich, dass damit eine Entwicklung zum Abschluss gekommen ist, die mit der Nazi-Zeit hier in Deutschland begonnen hat. Die gesamte Psychoanalyse wurde nämlich gezwungen zu emigrieren – und ist in Amerika in die Waschanlage der medizinischen Psychiatrie geraten und dort medizinisiert worden. In diesem Zustand ist sie zurück nach Europa gekommen und hatte da die erste Färbung, nämlich jetzt als eine medizinische Psychoanalyse plötzlich zu funktionieren, wogegen Freud sich sein Leben lang gewehrt hatte. Aber es half ihm nichts: „Psychoanalyse als Magd der Psychiatrie“, es half ihm nichts. In dieser Form ist es zurückgekommen und hier dann bei Huber und anderen gelandet. Huber wusste noch nicht so genau, was Neurose war – er hat es nur reingenommen. Aber die nächsten schreiben schon ganz ausführlich über Neurosen, als hätte die deutsche Psychiatrie sie erfunden. Das nenne ich Raub. Wie nennt man das in der Medienlandschaft? Wenn einer einen Film eines anderen unter seinem Namen zeigt? Plagiat. Halte ich für zu harmlos. Na ja. Das erklärt jedoch, warum die Medizinfunktionäre das einfach nicht begreifen, wenn man auf die historischen Wurzeln der verschiedenen psychologischen Entwicklungen – Psychoanalyse, aber eben auch die Entwicklungen an den Hochschulen – hinweist und sagt, das hat mit Medizin gar nichts zu tun. Das verstehen die überhaupt nicht. Weil das in dieser medizinisierten Form Eingang in die Medizin gefunden hat. In der Wirtschaft nennt man das heute „schlanke Produktion“, und zwar bedeutet das: Man entwickelt ein Produkt, lässt aber alle Kosten, die das Produkt im Vorfeld und im Umfeld macht, auf andere Firmen abplatzen; also etwa man hält selber kein Lager, sondern lässt dieses Lager von Vorproduzenten halten, und die haben dann die Kosten für die Lagerhaltung. Die „schlanke Produktion“ nimmt nur das jeweilige Produkt rein in die Produktion und hat dann „schlanke Gewinne“. So kommt mir das vor. Der Psychiatrie ist es gelungen, eine „schlanke“ Psychoanalyse zu erstellen. Wenn man nämlich dann die GOÄ-Ziffer liest oder hier – wo war das Ding – den Diagnosenschlüssel. Was da „Zwangsneurose“ ist, da bleibt einem wirklich das Hirn stehen. Das ist „schlanke Psychologie“ und „schlanke Psychoanalyse“, nämlich befreit von jedem Denkballast. Den haben wir, da dürfen wir uns drum kümmern. Die Abrechnung soll an anderer Stelle passieren. Jetzt sind wir soweit. Wir können diesen ganzen Krempel mal beiseite schieben und uns zurückversetzen in die Zeit, als Freud sich um Psychologie gekümmert hat; als er darauf stieß, dass das, was er da macht, mit Medizin gar nichts zu tun hat, sondern dass er dabei war, eine Psychologie zu machen. Ich habe mal die Titel zusammengestellt, um die Freud sich gekümmert hat; solche Probleme werden Sie in diesem Glossar mit Sicherheit nicht finden. Die können Sie auch der Krankenkasse gegenüber gar nicht anmelden, dass Sie so etwas in der Psychotherapie behandelt haben. Das hört sich also so an: „Die Abwehr-Neuropsychosen – Versuch einer psychologischen Theorie“, „Die Traumdeutung“ – die nach wie vor zugleich eine Kunsttheorie ist. „Zur Psychopathologie des Alltagslebens“, „Psychische Behandlung (Seelenbehandlung)“, „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“, „Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse“ – also Strafrechtsbereich. „Zur sexuellen Aufklärung der Kinder“, weil damals die Reformpädagogik auf und nieder sexuelle Aufklärung betrieb. „Der Wahn und die Träume in Jensens Gradiva“, „Zwangshandlungen und Religionsübungen“, „Der Dichter und das Phantasieren“, „Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci“, „Über den Gegensinn der Urworte“, „Die Bedeutung der Vokalfolge“, „Totem und Tabu“ – das Ethnologische –, „Märchenstoffe in Träumen“, „Der Moses des Michelangelo“, „Zur Psychologie des Gymnasiasten“, „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“, „Vergänglichkeit“, „Das Unheimliche“, „Massenpsychologie und Ich-Analyse“, „Die Frage der Laienanalyse“, „Die Zukunft einer Illusion“ – wieder eine Beschäftigung mit der Religion –, „Der Humor“, „Das Unbehagen in der Kultur“, „Zur Gewinnung des Feuers“, „Warum Krieg?“, „Moses, sein Volk und die monotheistische Religion“, „Das Medusenhaupt“.
Das sind die Titel, die sich nicht im engeren Sinne mit psychoanalytischer Klinik befasst haben. Da gibt es natürlich auch jede Menge. Ich habe die Kulturthemen aber mal zusammengestellt, um klarzumachen, womit hat der Mann sich eigentlich beschäftigt, wenn er von Neurosen sprach – schließlich und letztlich? Das Rätsel löst sich sehr einfach. Die Seele ist zwar in der Lage, einen Diagnosenschlüssel in diesem Sinne zu machen und diese Auflistungen hier zu erstellen. Sie ist aber letztlich an solchen Vereinfachungen nicht interessiert. Die Seele holt sich ihre Probleme nicht aus irgendeinem von Politikern vorgeschriebenen Bereich des Lebens, sondern sie holt sie sich rücksichtslos aus allen Lebensbereichen. Die Seele ist in der Lage, Lebensbereiche neu zu schaffen, neu zu entwerfen, zu konturieren. Sie denkt aber nicht daran, sich an einen dieser Lebensbereiche zu halten und sich darauf zu beschränken; d. h. das, was dann tatsächlich in den psychotherapeutischen Behandlungen hinter der Tür passiert, ist nicht das, was in der GOÄ steht, und nicht das, was im Glossar steht, sondern da geht die Seele rücksichtslos vor. Wenn wir anfangen, Neurosen zu behandeln, dann tun wir das sicher, weil irgendeine Art von Leid die Leute zu uns gebracht hat. Dieses Leid ist aber, indem die neurotische Gestalt umgebaut wird, sehr schnell weg. Und dann heißt meine erste Frage: Was gedenken Sie mit den nächsten 50 Jahren zu tun? Und die zweite Frage ist: Welche Spur wollen Sie auf diesem Globus hier hinterlassen? D. h. ich denke ja gar nicht daran, mich an irgendeinen Neurosenkatalog zu halten, sondern meine Zielfrage ist: Was will diese Person im Laufe des ihr noch verbleibenden Lebens auf dieser Welt anrichten, weiterentwickeln? Damit liegt es eigentlich bereits auf der Hand, dass die Psychotherapie keine Beseitigung von Neurosen ist, wie etwa die Beseitigung eines Beinbruchs. Dass es nicht darum geht, etwas weg zu machen, sondern in der psychologischen Psychotherapie kommt regelmäßig etwas dazu. Und das ist das Unfassbare für Politiker, dass da etwas dazu kommt – das soll dann auch noch finanziert werden. Wir werden aber, das ist meine Hoffnung, von diesem Ansatz aus, den ich Ihnen heute etwas entwickelt habe, vielleicht auch eine andere Argumentation entwickeln können, denn die Politiker sind ja nicht uneinsichtig. Die wirklichen Feinde sind bestimmte Sortierungen von Medizinfunktionären, welche die Sache kaputt machen wollen. Ein Medizinfunktionär, der etwas mehr auf unserer Seite ist, sagt: „Die Psychotherapie braucht die Medizin nicht, aber die Medizin braucht die Psychotherapie.“ Und nach all dem, was ich Ihnen entwickelt habe, ist es eine dreiste Anmaßung bestimmter Medizinfunktionäre, im Bereich der Psychotherapie einen Autoritätsanspruch erheben zu wollen. Was mich wundert, ist, dass in der ganzen Diskussion das Grundgesetz überhaupt nicht auftaucht. Denn wenn wir anfangen, über Psychotherapie und anerkannte/nicht anerkannte Richtungen innerhalb der Psychotherapie reden zu wollen, dann ist das überhaupt keine Sache von Politikern oder Medizinfunktionären, sondern die Sache steht eindeutig im Artikel 5 des Grundgesetzes, Absatz 3: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet allerdings nicht von der Treue zur Verfassung. Das ist die Grundlage für psychologische Psychotherapie und natürlich auch für alle Entwicklungen innerhalb der Psychotherapie; da werden wir uns von außen nicht hineinreden lassen, und wir erwarten mit Spannung den Gesetzesentwurf. Denn dann ziehen wir noch einmal ein bisschen mehr vom Leder.
Hinweis:
Dieser Artikel ist eine Neuauflage und wurde per Hand ins Digitale übertragen sowie an die neue Rechtschreibung angepasst. Wir bitten um Nachsicht für eventuelle Fehler.
Anmerkung und Literatur
Überarbeitete Fassung eines Tonbandmitschnittes des auf dem Kongress gehaltenen Vortrags.
Berk, H.-J./Stelzner, W.-D. (1992): Zur Entwicklung des klinischen Blicks in Medizin und Psychologie. Zwischenschritte (11) 2 (89–97).